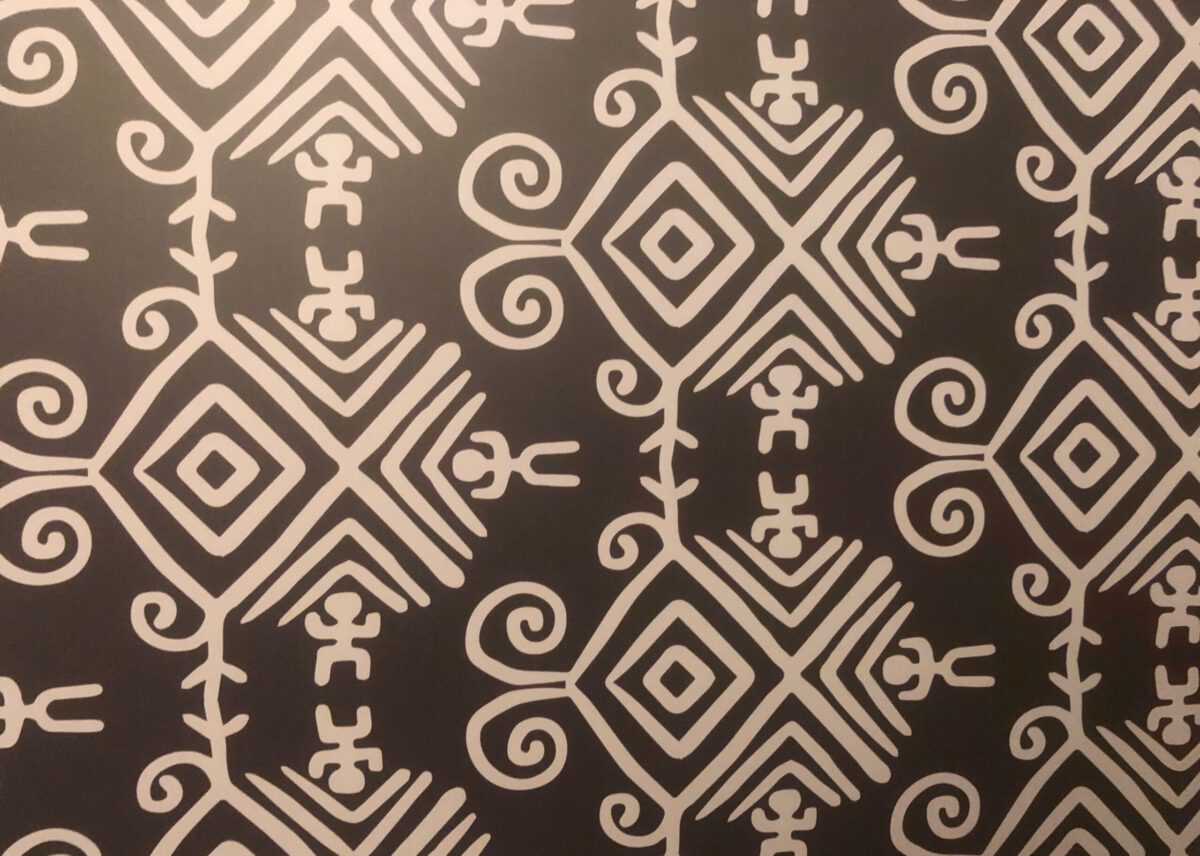Die Next Society wird nicht nur auf die Einführung des Computers reagieren, sondern auch auf die Entstehung einer neuen Weltordnung.
Auf einmal wollten alle fit für die Zukunft sein, damals, Mitte der neunziger Jahre des letzten Jahrhunderts. Weg mit den Ärmelschonern in den Amtsstuben und der umständlichen Bürokratie in den Kommunen. Die Stadt als Unternehmen, das war die neue Vorstellung in den Köpfen, Public-Private Partnership, der Markt kann alles besser, und deshalb wurden nicht nur Stadtwerke und Krankenhäuser, sondern auch Hunderttausende von Wohnungen an private Unternehmen verkauft und die Freiflächen in den Städten noch dazu. Heute ist die Wohnungsfrage wahrscheinlich das größte soziale Problem in unserem Land; die öffentliche Hand hat ihren Einfluss aus der Hand gegeben und ist weitgehend machtlos. Die Globalisierung der Immobilienmärkte trägt wesentlich bei zu der extremen Kluft zwischen Reich und Arm, die wir heute beklagen. Diese Entwicklung wäre so nicht möglich gewesen ohne einen aktiv betriebenen kulturellen Wandel in den Köpfen – die Verschiebung unseres Wertesystems vom Wohlfahrtsstaat zum neoliberalen Denken. Die Politik war vollauf damit beschäftigt, sich für die Zukunft fit zu machen, anstatt die Zukunft selber zu gestalten. So hat sie die Situation, unter der wir jetzt leiden, selber mit zu verantworten.
Derzeit ist wieder viel die Rede von der Zukunft und der Gesellschaft, die sie hervorbringen wird, die Next Society. Folgt man Peter F. Drucker, der den Begriff geprägt hat, dann ist die Next Society »die Gesellschaft, die auf die Einführung des Computers zu reagieren beginnt« (Dirk Baecker, Studien zur nächsten Gesellschaft, Suhrkamp 2007, S. 8). Sie wird sich deshalb „in allen ihren Formen der Verarbeitung von Sinn, in ihren Institutionen, ihren Theorien, ihren Ideologien und ihren Problemen, von der modernen Gesellschaft unterscheiden“. Wie aber will man sich auf eine Zukunft vorbereiten, die sich von allem unterscheidet, was man kennt? Peter F. Drucker selber weist den Weg: The best way to predict the future is to create it. Ein sehr guter Rat; er taugt auch als Anregung für die Kulturpolitik, die ja auch Gesellschaftspolitik ist und den kulturellen Wandel im Auge hat: sich nicht nur fit für die Zukunft zu machen, sondern diese aktiv mitzugestalten.
Neue Horizonte in der Next Society
Die Debatte über die Next Society im Zeichen der Digitalität wird besonders intensiv in der Welt der Unternehmen geführt; wie stellt man sich für die Aufgaben und Chancen der Zukunft am besten auf? Es geht um neue Formen des Managements, Agieren in Netzwerken, Innovationsfähigkeit, vor allem Beweglichkeit und Offenheit für neue Spielregeln, für den Aufbruch ins Unbekannte. Auch die Kultureinrichtungen beginnen ihre Arbeitsweisen zu überprüfen und im Sinne der Digitalität neu auszurichten, insbesondere im Zusammenhang mit den Forderungen nach Nachhaltigkeit, Transformation, Resilienz. Und die Kulturschaffenden tasten sich auf kreative Weise an die faszinierenden Möglichkeiten heran, wie sich die Welt mit digitalen Mitteln neu wahrnehmen und neu darstellen lässt, auf dem Weg zu einer Ästhetik der Zukunft. Neue Horizonte öffnen sich, alles scheint möglich, auch eine intensivere Vernetzung und Verständigung zwischen den Kulturen rund um den Globus. Selbst der Brückenschlag zu nicht-menschlichen Lebensformen ist nicht mehr ausgeschlossen.
Die Entstehung einer neuen Weltordnung
Auf der globalen Ebene vollziehen sich derzeit ähnlich grundstürzende Veränderungen. Wir leben in einer aufgewühlten und zutiefst verwirrenden Zeit, die vertrauten Koordinaten kommen ins Rutschen. Es schält sich eine neue Weltordnung heraus, die noch nicht klar in den Konturen ist, aber mit Sicherheit eine multipolare sein wird. Die Vorstellung von starren, auch hierarchischen Blöcken – Ost-West, Nord-Süd – könnte vom Bild des Netzwerks abgelöst werden: Die Staaten und Gesellschaften, die den Globus umspannen, sind auf unterschiedliche und vielfältige Weise miteinander verflochten; was sie eint, ist die geteilte Gefahr von Klimawandel und Umweltzerstörung, die Sorge um das Überleben der Menschheit. Die Erde als Schicksalsgemeinschaft.
Die Next Society wird also nicht nur auf die Einführung des Computers reagieren, sondern auch auf die Entstehung einer neuen Weltordnung, also etwa auf die veränderte Rolle des sogenannten »Westens«. Die Dominanz des »Westens« und seiner Kultur beginnt sichtlich zu bröckeln. Die Demokratie als Staatsform und Vorbild hat in vielen Gegenden der Welt Glanz und Überzeugungskraft verloren; im Blick auf Kolonialherrschaft, Rassismus und Umweltzerstörung wirken die »westlichen Werte« schal und werden in vielen Teilen der Welt nicht mehr respektiert. Dies bedeutet nicht nur einen Verlust an politischer und wirtschaftlicher Macht, sondern auch eine schmerzhafte Trübung des Selbstbildes auch in unserem Land. Unsere Art, Leben und Gemeinschaft zu organisieren, scheint nicht mehr die einzig wahre zu sein und keineswegs überall erwünscht. Wir werden unsere Geschichte mit neuen Augen sehen und unsere Rolle in der Welt neu bestimmen müssen. Auch die auf Beherrschung ausgerichtete Haltung der »westlichen« Kultur gegenüber Natur und Umwelt, die jetzt in ihren zerstörerischen Auswirkungen offen zutage tritt, gilt es neu zu bewerten. Indigenes Wissen ist dem unseren in mancher Hinsicht überlegen. Wir können uns heute nicht mehr selbstverständlich als Krone der Schöpfung fühlen und stehen vor der Aufgabe – ganz im Sinne der UNESCO-Erklärung zur Kulturellen Vielfalt –, im Austausch mit anderen Kulturen unsere Identität und Haltung zur Natur kreativ zu erneuern. Das ist eine enorme Herausforderung für die Kulturpolitik, gerade angesichts des Rechtsrucks in den »westlichen» Gesellschaften, der möglicherweise auch auf den oben beschriebenen Selbstwertverlust zurückzuführen ist. Was, wenn die Next Society faschistische Züge annehmen würde, mit all den Machtmitteln, die die Digitalisierung bietet? Der Verlust der Privatheit, eine Begleiterscheinung der Digitalität, die wir bislang nur wenig thematisieren, könnte dann katastrophale Folgen haben. Würde Künstliche Intelligenz unser Gefühl für Realität untergraben, wäre die Gesellschaft jeder Manipulation hilflos ausgeliefert.
Der Faktor Macht in der Next Society
Bei der Betrachtung des kulturellen Wandels auf dem Weg in die Next Society sollte die Kulturpolitik – neben ihren Aufgaben bei der Mitgestaltung des neuen Weltbilds – also auch den Preis im Auge haben, den sie möglicherweise für die Segnungen der Digitalität bezahlt. Werden die Werte, die sie bisher vor sich hergetragen hat – Demokratie, Gemeinwohl, Souveränität des Individuums und immer dringlicher Nachhaltigkeit – in Zukunft noch gelten? Und vor allem: wie ist das mit dem Faktor Macht in der Next Society?
Im Januar 2024 brachte die Wirtschaftswoche die aktuelle Forbes-Liste der zehn reichsten Menschen der Welt. Das sind alles Männer, und fast alle beziehen ihren Reichtum aus der Privatisierung unserer Daten. Sie sind es, die die digitale Welt kontrollieren. Mit ihren Unternehmen beeinflussen sie unsere Kultur, unsere Werte und Narrative bis in den letzten privaten Winkel. Sie üben Macht über weite Teile der Gesellschaft aus und vergrößern die Kluft zwischen Arm und Reich noch einmal stetig und in frivolem Ausmaß. Was in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts die Aneignung von Grund und Boden und öffentlichen Einrichtungen war, das ist jetzt die Verfügung über die Köpfe der Menschen selbst. Die ohnmächtig wirkenden Bemühungen der Politik um eine Regulierung von Künstlicher Intelligenz zeigen dies beispielhaft. Schon gibt es Befürchtungen, es könnte nicht mehr gelingen, transparente demokratische Wahlen durchzuführen. Und das Ende der Privatheit, der persönlichen Souveränität, scheint mehr oder weniger besiegelt. Niemand weiß, wie die Zukunft aussehen wird. Aber wenn die Kulturpolitik den Anspruch aufrechterhalten will, sie mitzugestalten, dann muss sie sich der Tatsache stellen, dass wir uns – privat und als Gesellschaft – durch die Digitalisierung in eine schicksalhafte Abhängigkeit begeben. Bei aller Ungewissheit scheint eines zumindest plausibel: Es kann keine gute Idee sein, einer Handvoll superreicher Männer die Gestaltung der Next Society zu überlassen.

Eva Leipprand führt ein Leben zwischen Literatur und Politik. Sie war Kulturbürgermeisterin in Augsburg, Sprecherin der Bundesarbeitsgemeinschaft Kultur der Grünen, Mitglied im Bundesvorstand der Kulturpolitischen Gesellschaft und Vorsitzende des Verbands deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Sie ist Mitglied im PEN-Zentrum Deutschland. Ihr Schwerpunktthema ist Kultur und Nachhaltigkeit.