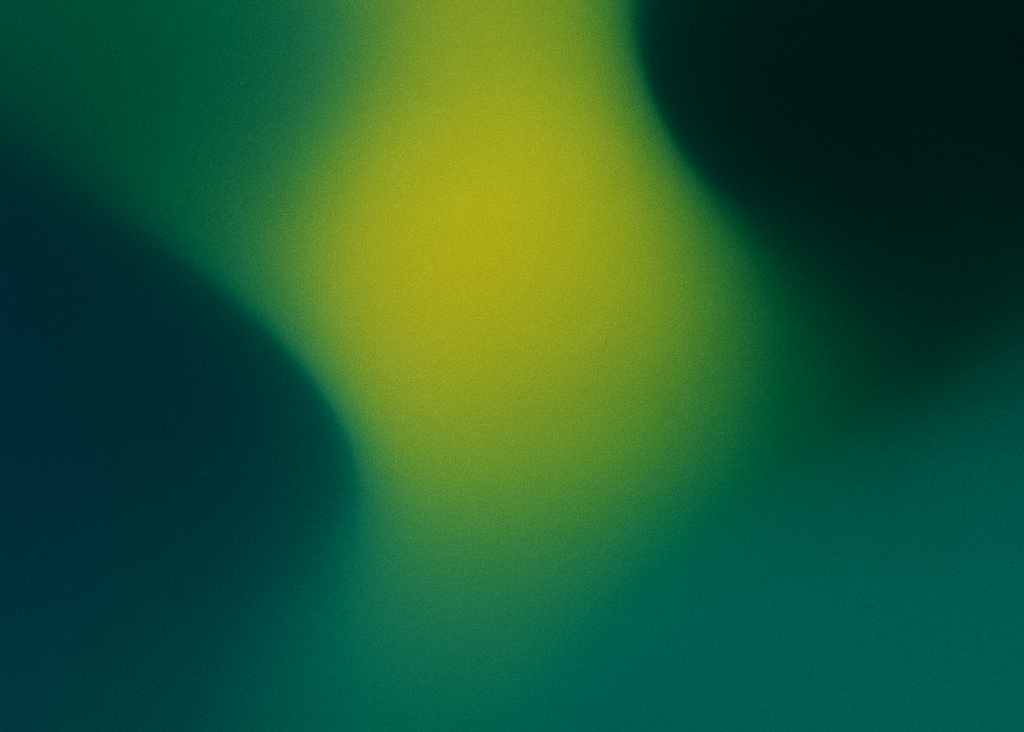Wir blicken oft eindimensional auf Nachhaltigkeit, in Deutschland meinen wir meist ökologische Nachhaltigkeit, wenn wir davon sprechen (anders als z.B. in der Schweiz, wo es viel um soziale Nachhaltigkeit geht). Dabei ist es hilfreich, Nachhaltigkeit in ihren drei Dimensionen zu verstehen – ökologisch, sozial und ökonomisch. Gerade beim Blick auf Digitalisierung. Eine digitale Nachhaltigkeit muss ebenso sozial wie ökologisch und ökonomisch gestaltet werden, wie eine nachhaltige Digitalisierung.
Gerne stellen wir uns vor, wie Digitalisierung unsere Probleme löst, etwa bei Fragen der Nachhaltigkeit. Wir ersetzen vor Ort Meetings durch remote Meetings und setzen generative K.I. statt Fotograf*innen ein. Das ist – wenn überhaupt – nur ökologisch nachhaltig.
Nehmen wir das Beispiel generative künstliche Intelligenz. Viele nutzen inzwischen ausführlich generative K.I., vor allem im Text-Modus als Companion, um eigenes Wissen zu überprüfen und weiterzuentwickeln. Den meisten ist dabei wohl bewusst, dass der Energieverbrauch von K.I.-Anwendungen wie ChatGPT hoch ist, ebenso wie der Wasserverbrauch. Dem Energieverbrauch kann dabei schnell begegnet werden, indem die K.I. lokal läuft und damit der Energieverbrauch selbst bestimmt und damit hoffentlich in der Kulturorganisation sowie dem Zuhause mit 100% erneuerbarer Energie erbracht wird. Es bleibt natürlich noch der Energieverbrauch für das Training des LLMs (large language models), ganz CO₂-frei ist K.I. also nicht zu haben, aber immerhin.
Das wäre der Blick auf die ökologische Dimension, wie sieht es bei der sozialen Dimension aus? Selbst wenn wir die Fragen nach Urheberrecht und Entlohnung von Künstler*innen beim Training von LLMs erstmal ausklammern, bleiben Fragen sozialer Gerechtigkeit und der Bezahlung, wenn z.B. generative K.I. zunehmend Fotograf*innen und andere Künstler*innen ersetzt. So wird es also zunehmend wichtig, diese Fragen gemeinsam zu verhandeln und mit zu betrachten, welche negativen Effekte wir erzeugen, selbst wenn wie in diesem Beispiel auch positive Klimaeffekte erzeugt werden, weil wir keine energie- und mobilitätsaufwändige Fotoproduktion haben.
Ein anderes Beispiel sind remote-Teamtreffen vs. Präsenz-Treffen. Sehr schnell sehen wir hier die großen CO₂-Einsparpotentiale im remote-Meeting. Das trifft auch zu, jedoch bei weitem nicht in dem Maße, wie wir uns das vorstellen. Als Institut für Zukunftskultur haben wir ein Beispiel durchgerechnet, nehmen 6 Personen an, die sich in städtischer Umgebung treffen oder eben auf zoom. Im Oktober, also an einem Ort heizen oder 6x zuhause, natürlich gehen die Personen auf Toilette, zuhause oder im Büro, trinken Kaffee, zuhause oder im Büro usw. Am Ende kommen wir auf einen Gesamtverbrauch bei einem remote-Treffen von 3,63 kg CO₂E gegenüber 8,42 kg CO₂E für ein vor Ort Treffen. Für ein remote-Treffen braucht ein Baum 2,78 Monate zur Kompensation, für das vor Ort Treffen 6,47 Monate. Das ist durchaus ein Unterschied, aber vermutlich deutlich geringer als die eigene Einschätzung bisher zum Thema, so bisherige Rückmeldungen zu dieser kleinen Beispielrechnung. Wir unterschätzen strukturell den Faktor Mensch, also das wir auch in remote-Situationen diverse Bedürfnisse decken müssen, in ökologischen Digitalisierungsfragen, wäre hier meine Ausgangsthese.
Zudem haben wir so nur bei der ökologischen Nachhaltigkeit gewonnen, während soziale Nachhaltigkeit im Beispiel zurück steht. Ganz klar ist, wir müssen uns in ökologischer Nachhaltigkeit massiv verbessern und können nicht die eine Dimension gegen die andere ausspielen. Natürlich müssen wir unserem ökologischen Fußabdruck massiv reduzieren, müssen unseren CO₂-Verbrauch massiv kürzen, weniger Frischwasser verbrauchen, uns für Biodiversität einsetzen und noch vieles mehr. Dafür brauchen wir aber erstmal einen realistischen Blick, wo wir tatsächlich relevante Sprünge machen und wo wir nur vermeintlich zu geringerem Verbrauch beitragen, während wir zentrale Praktiken im Kulturbetrieb aufgeben und damit an der Qualität von Kunst und Kultur schrauben.
Klimabilanzen sind dafür sicherlich ein hilfreiches Mittel, aber vor allem brauchen wir sinnvolle Gegenüberstellungen und Vergleichswerte, um bessere Entscheidungen treffen zu können. Dafür sollten wir viel mehr good practices sammeln und austauschen, um nicht vielfach die gleichen Erfahrungen immer wieder neu zu machen. Überblicksportale wie dieser Blog, aber z.B. auch tatenbank.org können uns dabei helfen, diesen Austausch herzustellen.
Während wir CO₂ und CO₂-Äquivalente (CO₂E) sehr genau bemessen können, fehlt es uns an guten und allgemeingültigen Instrumenten, die dies für soziale Nachhaltigkeit zu tun. Das macht es schwierig, gute Entscheidungen zu treffen, die zwischen den beiden Dimensionen adäquat abwägen können. Erste Projekte wie Leaving Handprints entstehen gerade, die sich dem Thema in der Kultur widmen, hier vor allem auf Festivals. Wir brauchen noch viel mehr davon, vor allem in allen Kulturspalten, um zukünftig nicht nur aktiver gestalten zu können, sondern auch auf erwartbare Abwehrkämpfe in zunehmend rechtskonservativer bis rechtsextremer Regierungen reagieren zu können.
Noch komplexer wird die Bewertung von sozialer Nachhaltigkeit digitaler Angebote und der Digitalisierung kultureller Angebote. Weitestgehend bekannt sind die Biases verschiedenster K.I.-Angebote, beispielsweise bei der Repräsentation marginalisierter Gruppen in z.B. generativer text-to-picture K.I.
Gerade wird durch erste Studien immer klarer, wie verschiedenste K.I. Companions die Ideologie der Tech-Konzerne auch in den Ergebnissen fortgeführt wird. Auch hier sollte die Schlussfolgerung nicht sein, die generelle Nutzung zu vermeiden, sondern zu Mitgestaltenden zu werden statt einfacher Nutzer*innen. Dazu brauchen wir noch viel mehr Kunst- und Kulturprojekte im und mit dem digitalen Raum und K.I., um die komplexen Zusammenhänge zu verstehen und uns so zu potenziellen Mitgestalter*innen zu ermächtigen.
Nachhaltige Digitalisierung und digitale Nachhaltigkeit sollten in diesem Sinne open source, open government und selbstgestaltet sowie ressourcenschonend und klimagerecht sein. Gerade hier kommt auch die ökonomische Dimension der Nachhaltigkeit stark zum Tragen, in der Art wie wir Software-Entwicklung fördern, in der Art wie wir Ausschreibungen gestalten, in der Art wie wir technische Infrastruktur aufbauen und welche Abhängigkeiten wir damit schaffen vs. welche Abhängigkeiten wir damit abschaffen. Dies ist nur ein kleines Beispiel der ökonomischen Dimension, diese sollte ebenso wie die soziale in unsere Überlegungen konsequent einbezogen werden.
Von diesen Idealen sind wir in der Breite meilenweit entfernt, aber jedes dieser Ziele ist möglich, wir müssen sie vor allem selbst leben und permanent auch einfordern, damit die Doppel-Transformation in Nachhaltigkeit und Digitalität sozial-ökologisch gelingen kann.

Foto: Christian Jungeblodt
Daniel Seitz ist Nachhaltigkeitsmanager, berät Organisationen aus Kultur, Bildung und Medien und setzt sich für Klimagerechtigkeit ein. Er leitet das Institut für Zukunftskultur und unterstützt dort Organisationen in ihren Nachhaltigkeitsbemühungen und setzt strategisches Nachhaltigkeitsmanagement mit ihnen um. Zudem bietet er mit dem Institut für Zukunftskultur regelmäßige Zertifikatskurse zur Nachhaltigkeitsmanager:in Kultur, Bildung und Medien an. Mit klimagerechtigkeit.net setzt er Projekte der politischen Bildung um.
Veranstaltungshinweis: Aktuell laufen Lunch-Sessions zur Einführung von Nachhaltigkeit, AI und Digitalisierung, organisiert vom Institut für Zukunftskultur. Infos und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es hier.