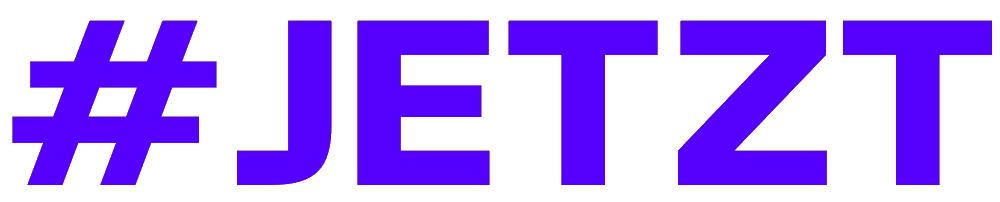Das Kunstschaffen hielt mir schon immer Strategien bereit, um Realitäten in ihrer Abstraktheit und Komplexität sichtbar zu machen. Ich verstehe Kunst dabei als eine Grenzensprengerin: Sie schafft Räume, in denen übertrieben und überzogen werden darf; in denen Themen experimenteller, frecher und ehrlicher verhandelt werden können als in anderen gesellschaftlichen und politischen Räumen. Auch die Subkultur als Toleranztante und Türöffnerin trägt zu gewissen Formen von Zugänglichkeit bei. Kunst hält damit etwas bereit, das der Autor und Behindertenpädagoge Christian Mürner den »Beteiligungscharakter der Kunst« nennt. Auch ich sehe darin ein inklusorisches Potential.
Wenn Kunst und (Sub-)Kultur Möglichkeiten für das Ausloten sämtlicher Transformationsprozesse bereitstellen, müssen sie als Progressionsrad eines sozialen und gesellschaftlichen Wandels verstanden werden. Dieses Kunstverständnis evoziert also eine Verantwortung. Doch es stellt sich die Frage: Wie kann Kunst in einem System, das allem einen vermarktbaren Wert zuschreiben will, transformativ agieren?
Das Problem, das in dieser Frage steckt, zeigt eigentlich ein weiteres Potenzial auf: Es scheint sich um einen Bereich zu handeln, der sich seiner Natur nach eigentlich nicht anpassen lässt – vielleicht dem System sogar diametral gegenübersteht. Auch das ist inhärent politisch. Diese Potenziale interessieren mich.
Während des #JETZT-Programms ist mein Ankerpunkt daher immer wieder die Auseinandersetzung damit, wie wir die Potenziale nutzen können: Also von dem Charakter des Kunstschaffens für eine gerechtere Kulturpolitik lernen. Das ist, was ich unter »junger« Kulturpolitik verstehe.
Als gerechtigkeitsorientiertes Bestreben kann eine »junge«, transformative Kulturpolitik jedoch nur eine sein, die von den entsprechenden Gruppen der Gerechtigkeitskämpfe getragen wird. »Wir profitieren jetzt von der Arbeit der sozialen Bewegungen, der organisierten Minderheiten der letzten Jahrzehnte und Jahrhunderte. Sie haben ihre Arbeit mit geringster institutioneller Unterstützung verwirklicht, ohne strukturelle Förderung und medialen Konfettiregen.«, sagen Fatima Çalışkan und Johanna-Yasirra Kluhs dazu in ihrem Beitrag »Handschlag mit der Realität«. Auch deshalb sollte gesamtgesellschaftliche Inklusion der grundlegende Parameter im kulturpolitischen Diskurs sein und unbedingt auch schon innerhalb der Diskursräume angewandt werden. Ein gesamtgesellschaftliches und »weites« Inklusionsverständnis beträfe ganz grundlegend den Abbau von Binaritäten und Normalitätskonstruktionen. Da diese alle Gesellschaftsbereiche einbinden, betrifft das letztlich eh uns alle. Als Menschenrechtsthema muss Inklusion deshalb unbedingt als Teil aller (kultur-)politischen Überlegungen sowie der intersektionalen Feminismen, Bewegungen der Klimagerechtigkeit und des sozialen Wandels verstanden werden.
So umrandet mein Denken insbesondere während der Formate »PANEL II: Kulturförderung in Deutschland« und »PANEL IV: Kulturpolitik der Diversität« des #JETZT-Programms immer wieder die Auseinandersetzungen mit dem Barriereabbau. Welche Strategien ermöglichen es marginalisierten Künstler*innen, sich einen nachhaltigen Platz im Kultursektor zu schaffen und wie werden sie durch die Kulturpolitik gestärkt, ohne sie dabei auf ihre Marginalisierung zu reduzieren?
Versucht man also, den Charakter des Kunstschaffens auf inklusions-theoretischer (und -praktischer) Ebene anzuwenden, sticht das Prinzip der »Dekonstruktion« ins Auge. Die Wissenschaftlerin Mai-Anh Boger beschreibt es in ihrem Praxis-Theorem »Trilemma der Inklusion« neben dem »Empowerment« und der »Normalisierung« als eine der drei Basissäulen von Inklusion. Dem Trilemma nach würden immer zwei dieser Säulen miteinander verbunden eine Definition von Inklusion ergeben, wobei die dritte Säule dann immer kategorisch ausgeschlossen werden müsse.
Eine Umsetzung dekonstruierend-empowernder Ansätze im Rahmen von Kulturpolitik würde voraussetzen, dass wir grundsätzlich einen systematischen Wandel im Kunst- und Kultursektor wie in allen Bereichen als Bedingung für Inklusion anerkennen. Und verstehen, dass mit dem Abbau von Normalitätskonstruktionen das Kunstschaffen und die -präsentation auch grundlegend anders gedacht werden muss.
Dass sich bisher nur wenige Strategien dazu etablieren konnten, zeigt, wie unzureichend dieser Ansatz bisher im kulturpolitischen Bereich berücksichtigt wurde. Nicht-normative künstlerische Werdegänge, wie es meist die von Autodidakt*innen, Künstler*innen mit Behinderungen bzw. marginalisierten Künstler*innen sind, führen oftmals in einen Bereich separiert vom Kunstbetrieb, der bezeichnenderweise als »Außenseiter-Kunst« besprochen wird.
Ein Teil der Lösung liegt in der Beantwortung einer Frage, die nicht nur für die sogenannten »Outsider-Artists«, sondern für alle freischaffenden – vor allem nicht-kommerziellen – Künstler*innen sowie Kurator*innen beziehungsweise Kunstaktivist*innen und anderen Vertreter*innen der freien Szene relevant ist: Die (finanzielle) Honorierung ihrer Arbeit. Deshalb muss sich eine »junge« Kulturpolitik dringend überlegen, wie sie es freischaffenden, nicht- kommerziellen Kunst- und Kulturakteur*innen ermöglichen kann, ihrem Beruf nachzugehen, ohne von (Alters-)Armut betroffen zu sein. Sprich: Wie holen wir das Kunstschaffen aus dem Prekariat? Gleichzeitig muss sie die freie Szene in ihrer Substanz und Struktur bedenken und überlegen: Welche Strategien gibt es, um die öffentliche Förderung von nicht-kommerziellen Kunstprojekten und -räumen nachhaltig zu sichern und resilienter gegenüber politischen Situationen und Gentrifizierung werden zu lassen?
Die Sicht einiger erfahrener Kulturpolitiker*innen im Programm #JETZT überrascht mich deshalb. Sie bekräftigen die Verhältnisse der bundesweiten und insbesondere der Berliner Kulturlandschaft: Wir würden so viel Geld wie niemand anderes für Kultur bereitstellen. Und: Es gäbe einen hervorragenden Austausch zwischen Praxis und Politik. In den Pausen zwischen den Panels ist meine Timeline von Statements bekannter Kulturräume wie dem Z/KU oder dem Sinema Transtopia geflutet, die gerade um ihre Existenz kämpfen oder schon schließen mussten. Mit dem Regierungswechsel in Berlin werden die Gelder für den Berliner Kulturbetrieb gerade teilweise halbiert. Oder gleich ganz gestrichen, wie das von Klaus Lederer zuvor beschlossene neue und dringend benötigte Förderinstrument der vierjährigen Konzeptförderung für Projekträume von 2024-2027. Das allein bedeutet, dass mehr als 1 Millionen Euro, die ohne Begründung aus dem Haushaltsentwurf für 2024/2025 genommen wurden. Dass diese Kürzungen nicht nur Verwaltungsakte sind, sondern reale Auswirkungen haben, zeigt sich gerade tragisch und zeugt für mich davon, wie fragil die Position von Akteur*innen und Räumen der Berliner Kunst- und Kulturlandschaft auch vorher war. Ich blicke auf einen Bereich, der schon vor den Kürzungen auf dem Rücken unbezahlter oder schlecht bezahlter Arbeit überlebt hat und einen ganzen Berufsstand, der seine Arbeit faktisch nicht (sicher) ausführen kann. Wie geht das mit den Aussagen der Politiker*innen zusammen? Ich höre: Das Prekariat gibt es auch in anderen Bereichen, und wenn man in die freie Szene ginge, wisse man ja, worauf man sich einlasse. Ich bin nicht sicher, ob ich mit der Antwort etwas anfangen kann. Ich frage weiter: Warum ist unter- bzw. unbezahlte Arbeit in der freien Szene überhaupt so normalisiert? Die Antworten sind weiterhin schwammig. Nur eines kommt immer wieder durch: Der Austausch darüber sei so wichtig.
Hm.
Bei genauerer Betrachtung steht auch selbst Aussage nicht ohne Problem: Meinen Beobachtungen nach scheint sich eben diese instabile Situation wiederum auf das kulturpolitische Engagement von freien Kunstschaffenden auszuwirken. Auf Netzwerktreffen, Symposien und Tagungen, in denen man sich quasi gewerkschaftlich und kulturpolitisch engagieren könnte, finde ich mich oft als einzige Person ohne echt-graues Haar wieder. Also frage ich sie: Warum engagiert ihr euch als »junge«, freischaffende Künstler*innen nicht gewerkschaftlich und kulturpolitisch für eure eigenen Rechte bzw. denen marginalisierter Künstler*innen? Und die meisten antworten, sie hätten schlichtweg keinen Kopf dafür. Sie fühlen sich vom System gedrängt, alle Kraft und Energie in das Geldverdienen und das »Irgendwie-Klarkommen« zu investieren. Sie scheinen im Einzelkampf vollkommen ausgelastet zu sein. Dabei ist es gerade für einen prekären und scheinbar gesellschaftlich relevanten Sektor entscheidend, dass der Drang zur gemeinschaftlichen Organisation und das Bedürfnis nach politischer Handlungskraft wahrgenommen und ausgetragen werden kann.
Mit den Erkenntnissen aus der Studienreise sowie dem Mentoring-Programm im Rahmen des Projektes #JETZT setze ich mir deshalb zum Ziel, Vorstellungen für die Entwicklung einer Art verbindlichen kulturpolitischen Manifests zu finden. Wenn dabei über Ideen und Werte hinaus auch Strategien für eine Art anwendbarer Code of Conduct entwickelt werden, könnte das einen Beitrag zur Sicherung kulturpolitischer Errungenschaften leisten. Das kann allerdings nur in der Zusammenarbeit zwischen Akteur*innen der Politik- und Kunstpraxis entstehen. Wer Lust hat, kann sich ja bei mir melden.
Quellen:
Bundesverband Bildender Künstlerinnen und Künstler (BBK) (2022): Leitfaden Honorare für Bildende Künstlerinnen und Künstler. Online abrufbar unter: https://www.bbk-bundesverband.de/fileadmin/user_upload/Leitfaden_Honorare_2023.01.03_online.pdf.
Çalışkan, F. / Kluhs, J.-Y. (2023): Handschlag mit der Realität. Gedanken zur Überholung des Kulturbetriebs. In: Reiner, S. / Sievers, S. / Mohr, H. (Hrsg.) (2023): Systemkritik! Essays für eine Kulturpolitik der Transformation. transcript Verlag: Bielefeld.
Boger, M.-A. (2017): Theorien der Inklusion – eine Übersicht. In: Förderverein bidok Deutschland e.V (Hrsg.) (2015): Zeitschrift für Inklusion. Jahrgang 10. Heft 1. Online abrufbar unter: https:// www.inklusion-online.net/index.php/inklusion-online/article/view/413.
Mürner, C. (2020): Der Beteiligungscharakter der Kunst: Art brut/Outsider Art und Inklusion. Beltz Juventa: Weinheim Basel.
Netzwerk freier Projekträume und -initiativen e.V. (2023): Zweiter aktualisierter Brief an die Mitglieder des Haushaltsausschusses vom Vorstand des Netzwerkes. online abrufbar unter: https:// www.projektraeume-berlin.net/wp-content/uploads/2023/10/Netzwerk_Brief_05102023.pdf.
Schaumburg, M./Walter, S./Hashagen, U. (2019): Was verstehen Lehramtsstudierende unter Inklusion? Eine Untersuchung subjektiver Definitionen. In: Katzenbach, D./Urban, M. (Hrsg.) (2019): QfI – Qualifizierung für Inklusion 1. Online abrufbar unter: 10.25656/01:20934 (DOI).

Anika Krbetschek
Frühlingsgeborene, Künstlerin, Kuratorin und Autorin aus Berlin, die mit und durch innerpsychische(n) Erfahrungen und deren Auswirkungen auf Identität und Wahrnehmung arbeitet.
Dabei geht sie über ein grundsätzliches Interesse an der Fremdheit des Empfindens und der Wahrnehmung hinaus und zieht Zusammenhänge zu einem gesellschaftlichen System und Diskursen um Gerechtigkeit. Auf diese Weise versucht sie, psychische und neurophysiologische Abweichungen, die außerhalb der vermeintlichen Normalität liegen, sichtbar zu machen und ihre Entstigmatisierung zu fördern. Durch verschiedene Erfahrungen, die sie innerhalb des psychiatrischen und therapeutischen Systems gemacht hat, hat sie eine Perspektive auf die Herausforderungen gewonnen, mit denen Menschen konfrontiert sind, die sich am Rande der Gesellschaft befinden. Um den Rahmen ihrer künstlerisch-aktivistischen Ziele zu erweitern, begann sie sehr bald, auch Ausstellungen zu kuratieren und Projekte zu initiieren sowie Texte zu veröffentlichen und auf Bühnen zu sprechen. Anika Krbetschek stellt nicht nur das Etikett »Krankheit« für innerpsychische Erfahrungen in Frage sondern überschreitet den Begriff der Grenzen auch künstlerisch und reflektiert die Rolle der zeitgenössischen Künste bei der Auseinandersetzung mit Fragen der Identität, der Wahrnehmung und Inklusion.