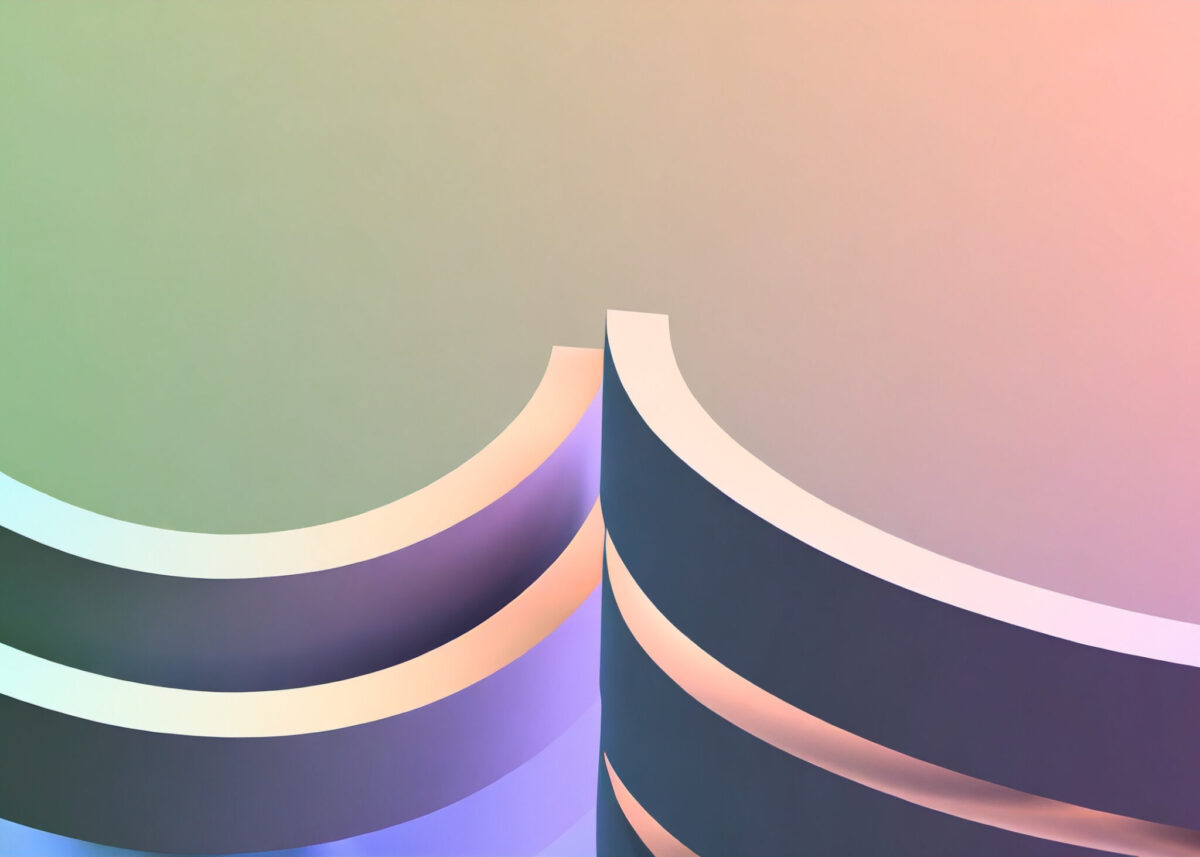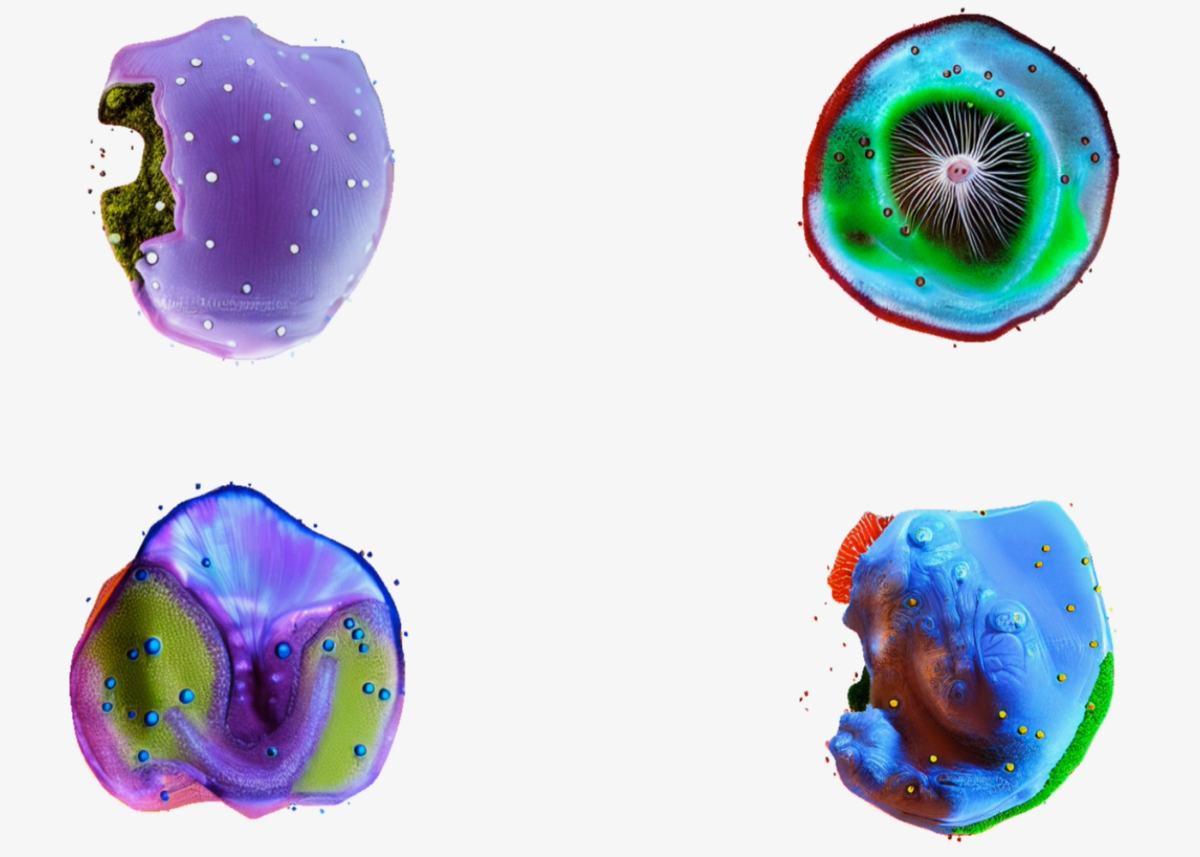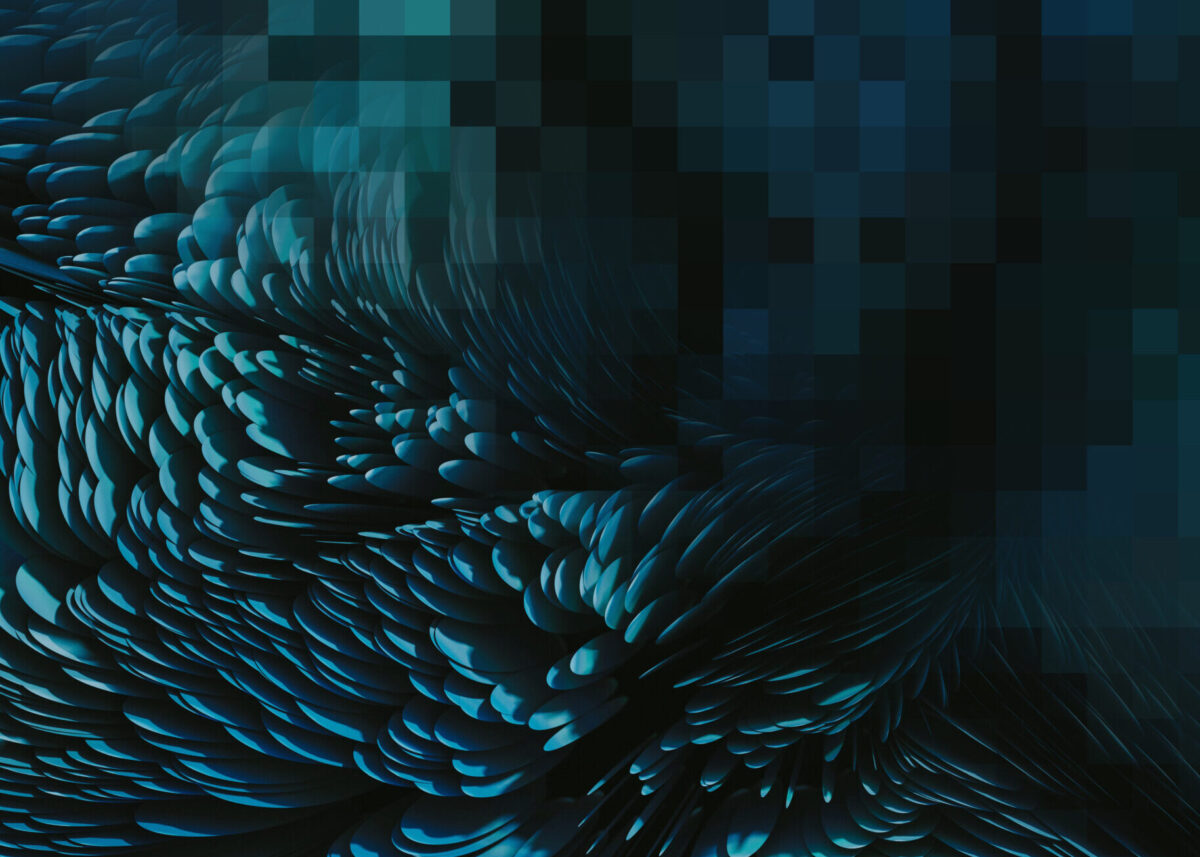Aushandlungsprozesse an Theatern können die Digitalisierung und nachhaltige Praktiken in ein zukunftsfähiges Zusammenspiel bringen: Als Motor gesellschaftlicher Prozesse kristallisiert sich derzeit in kulturpolitischen Zusammenkünften vielerorts ein »Utopien schmieden« heraus, so umschrieb es kürzlich der Leiter Digitaler Prozesse am Stadttheater Gießen Patrick Schimanski in seinem BLOG-Beitrag »Theater der Zukunft – eine Utopie« für das Projekt »Auf dem Weg in die Next Society?!« der Kulturpolitischen Gesellschaft. Der Autor bezog sich konkret auf zwei Veranstaltungen, die er selbst zusammen mit Maik Romberg, dem Leiter der Stabstelle Digitalisierung der Münchner Kammerspiele konzipiert und durchgeführt hat. In seinem Text entwickelte er inspiriert davon eigene Visionen zu einem »Theater der Zukunft«. Anfang Februar öffneten sich an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden an beiden Theaterhäusern Räume für Aushandlungsprozesse, deren Blick in die Zukunft gerichtet war. Die erfrischend vielseitigen Beiträge zur drängenden und praxisorientierten Notwendigkeit eines gesamtgesellschaftlichen Kulturwandels brachten wertvolle Impulse in die kulturpolitische Debatte und wurden damit zur Plattform, um Banden im Sinne von Vernetzungen zu bilden.
An die Nachgeborenen
Auf der Bühne der Münchner Kammerspiele wurden die Worte Reinhard Pfriems beim »2. Forum für Theater, digitale Transformation und Nachhaltigkeit« zu einem mahnenden Movens für die Ausrichtung der gesellschaftlichen Relevanz beider Symposien. Der Initiator und Mitbegründer des Institutes für ökologische Wirtschaftsforschung lieferte mit einer kritischen Bestandsaufnahme des aktuellen Aushandlungsfeldes, geprägt von den Nachhaltigkeitsbestrebungen, dem digitalen Zeitalter und der aktuellen gesellschaftlichen Lage, eine in ihrem Tiefgang wertvolle Grundlage für die lösungsorientierten Ansätze der Tagung. Inspiriert vom Theatermacher Bertolt Brecht setzte Pfriems Eröffnungsbeitrag »An die Nachgeborenen. Nachhaltigkeit, Digitalisierung und die Frage nach einer kulturellen Kehre« bei einem ernüchterten Rückblick auf die Historie der bis heute unzureichenden Bemühungen weltweit für einen nachhaltigen Kulturwandel an und verband diese mit kritischen Bedenken. Bei allen Chancen, die sich für ihn aus der Digitalisierung ergeben, mahnte er, ihre Schattenseiten, die er beispielsweise in »postdemokratischen Entwicklungen« erkennt, nicht zu verdrängen. Eine Kehre als umfassenden Kulturwandel wünschte er sich als »Ausstieg aus der fortschreitenden Zerstörung und der Schöpfung einer besseren Welt«. Angesichts der – nicht nur in den Alltagsnachrichten – vielseitig präsenten Dystopie und den sich überschlagenden gesellschaftlichen Herausforderungen konstatierte der erfahrene Ökonom eine »überbordende Erschöpfung« und rief zugleich in all seiner Skepsis zu einem »Trotzdem!« auf.
Vom Wert kulturpolitischer Aushandlungsprozesse
Für kulturpolitische Aushandlungsprozesse ist es wertvoll und wichtig, den Ernst der Lage und die Komplexität der Herausforderungen zu benennen. Zugleich gilt es, dies mit gegenseitiger Kenntnis von zukunftsweisenden Lösungsansätzen zusammenzuführen, Banden zu bilden, um gemeinsam Veränderungen kraftvoll voranzutreiben. Das können konkrete Werkzeuge der Digitalisierung sein, die als »Transformationshebel« den Wandel innerhalb der Kulturinstitution befördern, wie es Maik Romberg mit Blick auf sein Haus vorstellte. Die Nachhaltigkeitsbeauftragte der Schaubühne Berlin Lisa Marie Hobusch vermittelte über das kraftvolle Bild eines »Dinosauriers«, wie die beiden Leitmotive Nachhaltigkeit und Digitalisierung unbewegliche Kulturorte zu »jagen« vermögen. Die jeweils zuständigen Kolleginnen kamen in einen gemeinsamen Aushandlungsprozess, der agiles Handeln und mehr Dynamik in die Transformation des eigenen Betriebs brachte. Mit »Weg aus den Silos?« unterstrich Patrick Schimanski die notwendige Kooperation zwischen den Querschnittsthemen, um im Kulturbetrieb in nachhaltigen Organisationsstrukturen arbeiten zu können. Zudem hob er hervor, wie sehr die Digitalisierung nachhaltige Prozesse zu beschleunigen und damit auch den CO2-Fußabdruck zu verringern vermag. Der bewegende Vortrag »Gute Pläne sind nachhaltig« des Technischen Direktors des Stadttheaters Gießen Pablo Dornberger-Buchholz führte vor, wie die mittweilen sehr mühsamen Veränderungen in der eigenen Arbeitspraxis mitten im Kulturort zu einem begeisterten Plädoyer führen können, das im inspirierten eigenen Tun den Kulturwandel hin zu mehr Nachhaltigkeit vorantreibt.
Verknüpft mit dem Symposium fand in den Kammerspielen die Verleihung der Zertifikate an die mittlerweile fünfte Generation der »Transformationsmanager*innen Nachhaltige Kultur« statt, verliehen vom Aktionsnetzwerk Nachhaltigkeit. Dramaturgisch betrachtet führt dies zu neuen kulturpolitischen Banden und aktiver Vernetzung für weitere Aufmerksamkeit und Sensibilisierung, um die Verknüpfung von Digitalität und Nachhaltigkeit noch mehr zu fokussieren.
Konkret gestaltende Lösungsansätze
Der Soziologe Davide Brocchi regt in seinem Buch »By Disaster or by Design?«[1] an, sich von den apokalyptischen Szenarien abzuwenden und ihnen durch ein pro-aktives Gestalten etwas entgegenzusetzen. Wie unterschiedlich dies aussehen kann, wurde bei den facettenreichen Perspektiven und Stilen beider Symposien erfahrbar: Die Autorin Theresa Hannig entwirft in ihrem Roman »Pantopia«[2] die Utopie einer mit digitalen Potenzialen ausgestatteten und konsequent an Menschenrechten orientierten Weltrepublik. Als kommunale Kulturverwaltung versteht das Kulturforum Witten inmitten eines lebendigen städtischen Netzwerks Digitalität als Kunstform und eröffnet Möglichkeitsräume für Experimente. Damit entwickelt es nicht nur ein Pilotprojekt für Kultur und Kulturpolitik, sondern auch für die Stadtentwicklung. Über ein Kooperieren verschiedener Häuser, wie Kampnagel und Deichtorhallen in Hamburg und dem Hebbel am Ufer in Berlin wurde die Open Source Disposoftware »artwork« auf den Weg gebracht, die das Kulturmanagement an großen und kleinen Kulturorten effizienter, ressourcenschonender und kollaborativer aufstellt und weiterentwickelt. Hier entsteht – über ressourcenschonende Werkzeuge des Zusammenarbeitens hinaus – ein zukunftsweisender Gemeinschaftssinn. Als Kreislaufwirtschaft treibt das kurz vor der Umsetzung stehende Konzept des Szenografen-Bund mit einer nachhaltigen Online-Materialbibliothek und einer vernetzten Fundusplattform eine Art Revolution hin zu einem nachhaltigen Entwerfen und Produzieren am Theater voran. Das Performancekollektiv »ArtesMobiles« stellt Forschung und Entwicklung, Datenschutz und auch Partizipation ins Zentrum und öffnet damit insbesondere auch den nachwachsenden Generationen über ihre kulturelle Praxis Ermöglichungsräume für ein gutes Leben. Auch hier heißt es Banden bilden: So können kreative Aushandlungsprozesse im kritischen Hinterfragen und forschenden Vernetzen zu gelebten Utopien werden.
Dieser Beitrag wurde zuerst in den Kulturpolitischen Mitteilungen 184, I / 2024, veröffentlicht, S. 65-68.
[1] Davide Brocchi: „By Disaster or by Design? Transformative Kultur: Von der multiplen Krise zur Systemischen Nachhaltigkeit, Wiesbaden: Springer 2023.
[2] Theresa Hannig: Pantopia. Frankfurt am M.: Fischer 2022.

Dr. Uta Atzpodien (*1968) ist Dramaturgin, Kuratorin und Autorin und engagiert sich mit transdisziplinären (künstlerischen) Impulsen für einen gesellschaftlich nachhaltigen Wandel und eine kreative Stadtentwicklung. Promoviert hat sie mit »Szenisches Verhandeln. Brasilianisches Theater der Gegenwart« (transcript 2005). Seit 2006 lebt sie in Wuppertal, hat hier)) freies netz werk )) KULTUR mit gegründet und ist u.a. Mitglied des und.Instituts für Kunst, Kultur und Zukunftsfähigkeit. Sie ist Leiterin des Projektes »Auf dem Weg in die Next Society? Kulturen der Digitalität für einen nachhaltigen Wandel« der Kulturpolitischen Gesellschaft e.V.