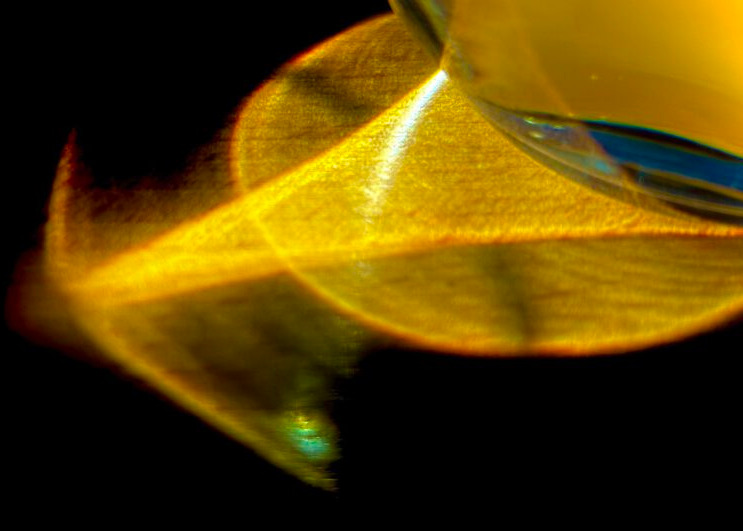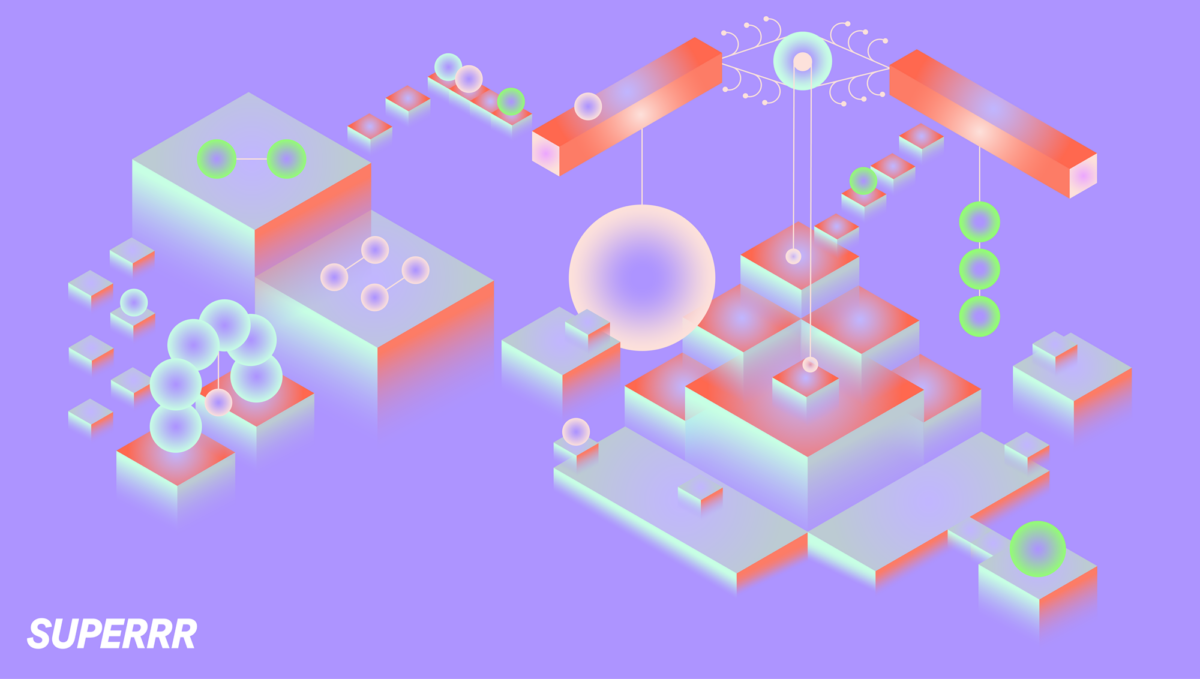»Aktuelle Erzählungen rund um technologische Entwicklungen sind durchzogen von Darstellungen des Unvermeidlichen. Es wird die Erwartung erzeugt, dass Menschen sich an die technologischen Entwicklungen anpassen müssen.«
Dieser Satz stammt aus einer ersten Version eines Ankündigungstext für das Panel »Unerreichbare Gegenwarten, unvermeidliche Enden« zu dem ich als Leiter des Büro medienwerk.nrw im Oktober 2025 Kulturtheoretiker, Soziologinnen und Medienwissenschaftler*innen eingeladen habe. Sie sprachen im Rahmen der MedienKunstTage NRW 2025 unter dem Motto »More Future!« über aktuelle Entwicklungen rund um die gefährlichen Zukunftsvorstellungen von Tech-Milliardären und darüber wie Macht, Geld und Ideologie hier zusammenkommen. In diesem Panel gelang es nicht unbedingt, den grundlegend optimistischen Ansatz, der der Veranstaltung zugrunde lag, durchzuhalten. Sie sollte Hoffnung nicht als naive Haltung, sondern als kritische Praxis verstehen.[1]
Dennoch, oder gerade deswegen, ist mir dieser Satz so lebendig in Erinnerung geblieben. Ich frage mich, was diesen Darstellungen einer von großen Firmen und ihren Entscheidungen (von Palantir bis OpenAI) geprägten Zukunft entgegengesetzt werden kann und wie sich die in dem Satz steckende Logik umkehren lässt: Wo können digitale Technologie und vernetzte Systeme vielgestaltige Vorstellungswelten öffnen, unterschiedlichste Arten der Nutzung hervorrufen und den Raum öffnen, frei und gleichberechtigt darüber zu sprechen und zu streiten, wie viel von welcher Technologie die grundsätzlich zur Verfügung steht, auch genutzt werden sollte. Und auch auf welche Weise.
Einer der Orte, an dem solche Freiräume erzeugt werden könnten, sind die Kunst- und Kulturinstitutionen. Voraussetzung dafür sind, neben der weiteren öffentlichen Finanzierung und der fortschreitenden Bemühung diese Orte für möglichst viele unterschiedliche Menschen zugänglich zu machen, eine andere Haltung »dem Digitalen« gegenüber sowie praktische Änderungen in kulturellen Infrastrukturen und Systemen.
Dazu folgen hier ein paar Denkanstöße in Thesenform[2].
Erste These
Wir müssen in Kunst und Kulturräumen besser informiert, vielgestaltig und ernsthaft über den Einfluss von Technologie auf jeden Aspekt unseres Zusammenlebens und unserer Zukunft sprechen und dies künstlerisch erforschen und zugänglich kommunizieren.
Denn nur weil wir etwas alle nutzen, bedeutet das nicht, das wir es verstehen.[3] Von Akteur*innen in Kunst und Kultur wird erwartet, alle Aspekte der zeitgenössischen Welt zu nutzen. Dabei verführen die einfach bedienbaren Services und Dienste zur regelmäßigen Nutzung und die immerwährende Ausführung über z.B. die Folgen von KI zum Gefühl, gut informiert zu sein und selbst mitsprechen zu können. Dabei sind wir umgeben von neu entstehenden Kommunikationswegen und Kulturtechniken, bei denen die Geschwindigkeit der Verbreitung in der Menschheitsgeschichte absolut einzigartig ist.[4] Gerade deswegen ist es notwendig, dass dieser große Teil unseres Lebens in Kunst- und Kultur stärker abgebildet wird und mehr Stimmen, sei es von Künstler*innen oder Wissenschaftler*innen, die sich schon seit längerem mit den Veränderungen kritisch und differenziert auseinandersetzen, gehört werden. Denn für demokratische Gesellschaften, in denen wir alle mitentscheiden, ist Wissen über die Zusammenhänge, ist ein Gefühl für die Richtung, in die sich Dinge entwickeln und ob das die richtige Richtung für ein möglichst gutes Leben für möglichst viele von uns ist, unabdingbar. Es braucht Räume, in denen diskutiert werden kann, was das »gute Leben« überhaupt sein könnte.
Zweite These
Um Freiräume für Kunst zu erhalten, brauchen wir Wege, die Dominanz großer Technologieunternehmen einzuschränken.
Wenn wir uns umsehen, so müssen wir feststellen, dass der digitale Raum unter zunehmender Kontrolle durch große Tech-Firmen ist.[5] Es braucht dort aber dringend Freiräume für Künstler*innen und Kultureinrichtungen, um gedanklich und in der Art der Produktion vielgestaltig bleiben zu können. Texte und bildliche Ästhetiken passen sich zusehends ein in externe Vorgaben (was findet die Suchmaschine, was erzeugt Clicks, welche Prompts brauche ich, um einen guten Text zu erstellen). Sich diesen Logiken nicht anzupassen, sollte Privileg und Stärke der Kunst bleiben.
Um dies zu ermöglichen, braucht es kontinuierliche Förderung, um Kulturräume im Internet zu sichern. Damit diese Förderung nicht direkt wieder zu den großen Tech-Unternehmen wandert, sollte Internet-Infrastruktur als staatliche Aufgabe verstanden werden, ähnlich wie bei anderen wichtigen Infrastrukturen. Ein kurzer Weg dahin wäre, wenn Kommunen und Bundesländer einen Teil ihres Etats für digitale Infrastruktur[6] von Kunst und Kultur ausgeben würden, sind sie doch in erster Linie für die kulturelle Versorgung in Deutschland zuständig.
In diesem Zusammenhang braucht es unbedingt den Willen von Kunst- und Kultureinrichtungen und staatlichen Stellen, nicht sehr viel Geld an Microsoft, Apple und (in Zukunft) OpenAI zu zahlen, sondern konsequent den Weg von Open Source und Open Access zu gehen.
Es sind aber nicht nur die Institutionen, bei denen Änderungen notwendig sind. Auch Künstler*innen können hier eine zentrale Rolle spielen, in dem sie sich z.B. vor Beginn einer Arbeit einer ausführlichen Recherche widmen, wo an bereits veröffentlichtem Wissen und Lösungen, die außerhalb der gängigen Programme bereits existieren, angeknüpft werden kann und aktiv nach Alternativen suchen zu ready-made Lösungen, die sehr viel Energie verbrauchen und Elend hervorbringen. Ebenso würde es helfen, wenn sie die Dokumentation und Zugänglichmachung von eigenen digitalen Projekten als eine ihrer zentralen Aufgaben verstehen.
Dritte These
Um Themen der digitalen Gegenwart in Kultureinrichtungen adäquat sprechen zu können, braucht es langfristige digitale Strategien. Sowohl in Kultureinrichtungen als auch in der Kulturpolitik.
Ein Grund für den Mangel an Strategie ist, dass die Integration von Digitalität in Kulturinstitutionen Zeit benötigt, die oft nicht zur Verfügung steht.
Kulturinstitutionen brauchen Offenheit und die Bereitschaft, eigene Ansätze und Lösungen zu teilen, aber auch sich umfänglich nach schon existierenden Ansätzen umzuschauen. Dafür braucht es Personalstellen auf denen sich Menschen ausschließlich mit Vernetzung, Austausch und Lernen beschäftigen können. Lernen von anderen digitalen künstlerisch-ästhetischen Ansätzen, anderen Kanälen und Themen – und die Möglichkeit dieses Wissen an geeigneter Stelle einzubringen.
Dies sollte einhergehen mit dem Willen zu Umstrukturierungen: Um mehr Zeit für eine geplante und durchdachte Einbindung digitaler Formate und Themen – und den Austausch darüber – zu ermöglichen, müssen alle existierenden Aktivitäten kritisch geprüft und teilweise durch neue Aktivitäten ersetzt werden. Die übliche Praxis, das Digitale als etwas zu verstehen, das »man auch noch nebenher macht« führt hier zu nichts.
Für all das ist zentral: Kulturinstitutionen brauchen Leitungspersonen, die einen grundsätzlichen Änderungswillen in diese Richtung haben und Überzeugungsarbeit dafür leisten. Im Idealfall erhalten sie dabei Unterstützung von einer Kulturpolitik, die Stellen innerhalb und außerhalb von Institutionen schafft: um Künstler*innen, Kunst- und Kulturinstitutionen zu beraten und neue Freiräume für zukunftsweisende Praxen zu ermöglichen.
Wenn wir davon ausgehen, dass die digitale Sphäre bereits tiefgreifend in unsere Leben eingedrungen ist und bestimmt wird durch handelnde Akteur*innen – die ihre eigenen, häufig nicht mit vielgestaltigen, nachhaltigen, demokratischen Zukünften zu vereinbarenden Pläne haben – brauchen wir für unsere eigenen Zukunftsvisionen auch (zumindest zum Teil) unsere eigenen digitalen Orte, Plattformen und Ästhetiken.
[1] Inwieweit das gelungen ist, lässt sich in folgenden Videoaufzeichnungen nachverfolgen: https://www.medienwerk.nrw/projects/more-future-medienkunsttage-nrw-2025/, sowie in den sehr lesenswerten Texten von Fabian Raith: https://www.medienwerk.nrw/articles/fabian-raith-usually-everyone-wants-it-they-just-dont-want-the-extra-work/ und den inhaltlichen Ergänzungen von Felix Maschweski und Anna-Verena Nosthoff: https://www.medienwerk.nrw/articles/die-welt-ist-nicht-genug-longtermism-als-moralphilosophie-des-untergangs/ nachlesen.
[2] Die Thesen wurden erstmals im Rahmen des Symposiums »Digitalität, Demokratie & Kultur« des Moovy Tanzfilmfestival in Köln im November 2025 präsentiert und für diesen Beitrag überarbeitet.
[3] Verstehen heißt hier aus meiner Perspektive sowohl die technische Infrastruktur, die sozialen Auswirkungen, die ökologischen Folgen, die Bedeutung für die Meinungsbildung und den Informationsfluss, die Entstehung von Gemeinschaften, das Denken in Zugehörigkeiten.
[4] Während wir zugleich auch weiterhin neue Dinge lernen. Dazu wie Sprache funktioniert, unser Denken und die nicht-menschlichen Systeme um uns herum. Zugleich sind wir selbst den Effekten von sogenannten Sozialen Medien, von XR-Räumen, von einigermaßen autonom agierenden Systemen wie sogenannten KI-Algorithmen, Neuronalen Netzen, LLMs und Bildgeneratoren ausgesetzt.
[5] Diese Erkenntnis ist nicht neu, die aktive Gegenwehr dagegen scheint jedoch, basierend auf dem was in Medien mit großer Reichweite sichtbar ist, zu erlahmen. Dafür, wie tiefgreifend die digitale Sphäre unseren Alltag, unsere Meinungsbildung und unsere Arbeitswelt prägt, ist »Netzpolitik« stark unterrepräsentiert. Trotz aller wichtigen Einwürfe u.a. von netzpolitik.org, digitalcourage.de, dem CCC.de und vielen weiteren wichtigen Akteur*innen.
[6] Mit Infrastruktur sind hier gemeint: Hardware (z.B. Server vor Ort statt in der Cloud) und Software (z.B. individuell anpassbare Lösungen zentral programmiert für alle Theater oder Museen statt die vielhundertfache Neuerfindung des Rades oder externe, einschränkende Programme).

Foto: PLZZO-Photography
Klaas Werner arbeitet an der Schnittstelle von Theater und Medienkunst. Sein gesteigertes Interesse gilt der Erforschung von Kommunikations- und Narrationspotentialen zeitgenössischer Medien sowie technischen Infrastrukturen. Als Gründungsmitglied von Anna Kpok entwickelt er im Kollektiv seit 2009 Theater-Games, on- und offline Performances, Installationen und interaktive Texte, die sich als Playful Encounters beschreiben lassen.
Anna Kpok kooperierte u.a. mit: Schaubude Berlin, Ruhrtriennale, Games Festival München, Theater Dortmund, Fidena, Ringlokschuppen.Ruhr. Außerdem war Klaas Werner zwischen 2015 und 2025 in verschiedenen Funktionen für das Büro medienwerk.nrw – Medienkunst und digitale Kultur in NRW – tätig, von März bis Dezember 2025 als Leitung. Er konzipiert und organsiert im Rahmen dessen Förderprogramme, Konferenzen, Workshops, Online-Reihen und Diskursveranstaltungen zu zeitgenössischen Themen aus den Bereichen Medienkunst und digitale Kultur. Zuletzt: More Future! MedienKunstTage NRW