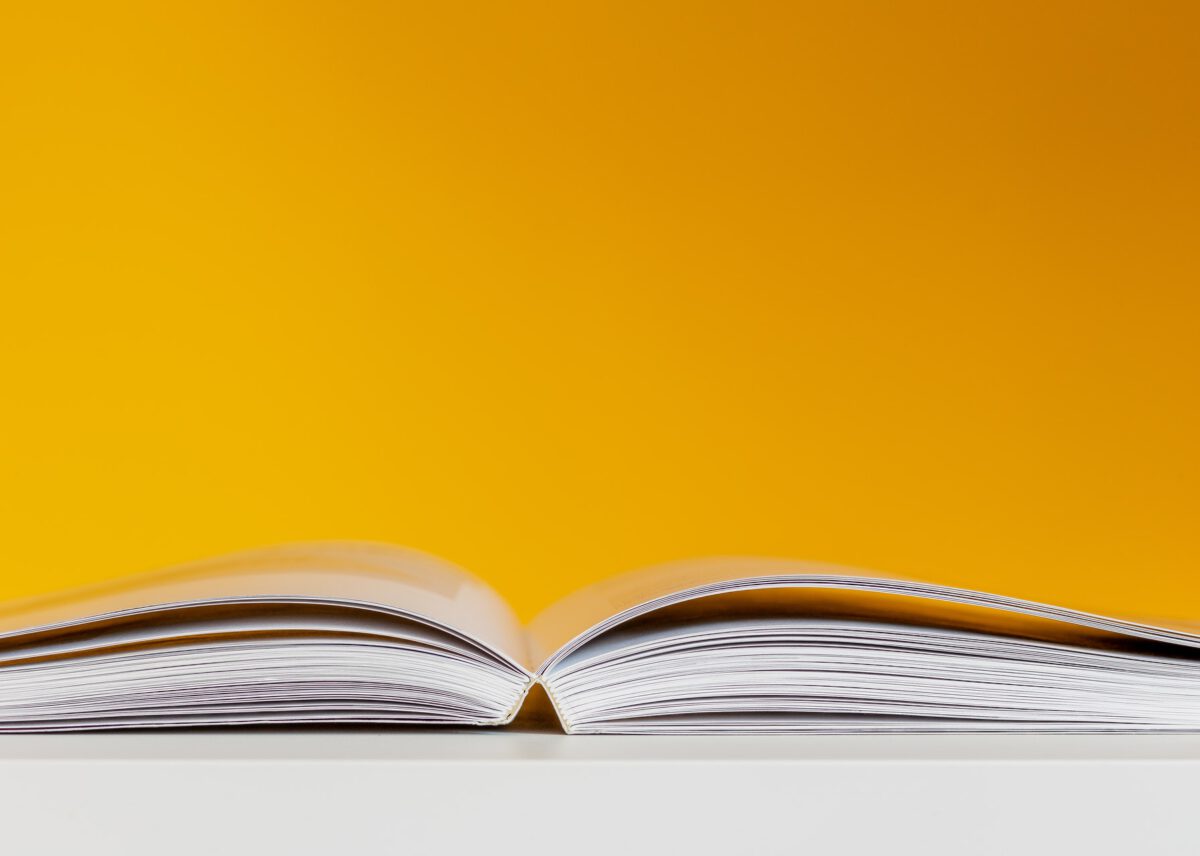Mein Schriftstellerinnendasein in diesem deutschen Literaturbetrieb ist so unwahrscheinlich, dass ich immer wieder meinen Werdegang, diese unmögliche Strecke, gedanklich zurücklaufe. Die Vergangenheit ist eine Abfolge der mir bekannten Schritte, in der Gegenwart stehe ich und bekomme manchmal keine Luft, wenn ich an die Zukunft denke: Kann ich diesen Beruf weiterhin in Würde ausüben? Kann ich mir den Luxus erlauben, vom Schreiben zu leben?
Ich denke an den Satz von Guy Debord: »Paris war eine so schöne Stadt, daß viele [Künstler*innen] lieber hier arm sein wollten als anderswo reich.«
Ich denke: Guy Debord musste in seinem Leben nie hungrig ins Bett gehen.
Ich denke: Selbstgewählte Armut ist keine Armut.
Ein ehemaliger Mitstipendiat der Heinrich Böll Stiftung in Berlin fragte oder schlug vor – ich weiß es nicht so genau – ich sollte nach Berlin ziehen und so wie er Teil der Bohème werden, weil er um meine schriftstellerischen Ambitionen wusste. Ich wusste damals nicht, wo ich mit meiner Erklärung anfangen sollte. Heute weiß ich: Sein Vater ist Chirurg.
Wer begibt sich freiwillig in existenzielle Not, wenn er damit aufgewachsen ist, wenn er davor geflüchtet ist?
Eigentlich bist du Lehrerin, fragt man, oder sagt man, und dann weiß ich, ich muss erklären, warum ich Lehramt studiert habe: Kompromiss zwischen mir und meinen Eltern, aber das ist nur die Hälfte von dem, was wahr ist, denn der Kompromiss ist auch zwischen mir (heute) und mir (damals), meiner Angst vor Armut und meinem Wunsch zu schreiben.
In der achten Klasse lesen wir Sonia Levitins Buch Die Tote im Wald – in der Autor*innenvita steht, dass sie Lehrerin und Schriftstellerin ist.
Meine Klassenlehrerin weiß, dass ich Schriftstellerin werden möchte; meine Eltern wissen, dass ich schreibe, aber beide Parteien wissen auch: Ich werde nicht davon leben, ich muss mir etwas Anständiges suchen – das sind die Worte meiner Lehrerin; das muss ich mit meinen Eltern erst gar nicht besprechen. Levitins Doppelberuf suggeriert, ich könnte als Lehrerin nebenbei schreiben.
Wer sollte wo lernen?, werde ich gefragt. Ich finde es unangenehm darauf zu antworten, weil meine Antwort nur vermessen sein kann. Wie könnte ich darüber urteilen, wer wo lernen sollte, selbst wenn ich dies – im Rahmen dieses Essays – theoretisch könnte, als Gedankenexperiment. Die Implikation dieser Frage ist wahrscheinlich, dass ich als migrantisches Arbeiterkind schreiben soll: Wir brauchen mehr migrantische Arbeiterkinder im Kulturbetrieb, weil der Kulturbetrieb in Deutschland eine homogene Masse ist – zumindest kann ich das dem Literaturbetrieb attestieren. (Der Literaturbetrieb, auch im Jahr 2020, ist immer noch elitär, weiß, bürgerlich und sehr geschlossen, obwohl aufgeschlossener als zum Beispiel die Kunstszene, aber deutlich biederer als die Musikszene).
Wer sollte wo lernen?
Ich habe keine Antwort, aber ein paar Gedanken.
Ich denke: Zumindest gibt es einen sehr schmalen Korridor für solche Schriftstellerinnen wie mich, die kein Kreatives Schreiben studiert haben und ohne Netzwerk, trotzdem in der deutschen Gegenwartsliteratur einen Platz zugewiesen (!) bekommen. (Die Besprechungen meiner Bücher, die Interviews und Lesungen, die Anfragen lassen mich zu dem Schluss kommen: Ich bin eine Vertreterin einer Art Nischenliteratur, aber nicht der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur, und jede weitere Erwähnung und Auseinandersetzung damit führt nur zu weiteren Verstrickungen.)
Wie kommt es, dass der Literaturbetrieb in Deutschland aus einer homogenen Masse besteht?, könnte eine selbstkritische Frage sein, die man sich stellte, würde einem die Homogenität auffallen. Auf der Bühne scheint zumindest seit den letzten Jahren die Homogenität aufgebrochen worden zu sein, aber hinter der Bühne werkeln immer noch ähnliche Akteure wie vor zwanzig und dreißig Jahren.
Ich denke: Würde man den Kanon abschaffen, würde man Goethe und Schiller und Büchner für eine Dekade aus dem Gedächtnis löschen, würde auch der Betrieb aufhören, nach der Stimme einer Generation zu suchen, endlich aufhören junge Männer, die nichts zu sagen haben, diese jungen Bohémien, diese Chirurgensöhne, zu feiern. Ich kenne die Gefühls- und Gedankenwelt dieser jungen Männer, in wie vielen Variationen soll ich das noch lesen? Keiner wird den nächsten Werther schreiben, er wurde schon geschrieben.
Wenn ich auf meine eigene Schreibbiographie schaue, sehe ich nur Frauen, die dafür gesorgt haben, dass ich schreibe, angefangen bei meiner Mutter bis Sandra Cisneros, dann Toni Morrison und Zadie Smith bis hin zu Shida Bazyar.
Ich weiß: Diversität als Marketingtool ist zu verachten, weil es die reelle Struktur nicht verändert, sondern kosmetische Veränderung ist.
Senthuran schreibt mir: Das Austauschen des Personals in einem Text, und der Marker, ist keine neue Literatur sondern nur Repräsentationspolitik. Ich like seine Nachricht. Wenn statt Kaffee Chai getrunken wird, wenn statt Alex Ahmet da steht, wenn Alltagsrassismus den Text schmückt, aber der Text in seiner Grundstruktur sich kaum von anderen Texten unterscheidet, stellt sich die Frage: Warum schreiben? Stell dir vor, du schreibst nicht für ein deutsches Publikum, sondern du schreibst. Wie würdest du schreiben? Stell dir vor, niemand wird deinen Text lesen, stell dir vor, du bist die einzige Person, die den Text lesen würde, würdest du immer noch deinen Text dir selbst erklären? Ich habe mich dessen auch schuldig gemacht:
In meinem Roman Beschreibung einer Krabbenwanderung erzählt die Protagonistin, im Irak würde man wegen der erdrückenden Sommernächte auf dem Dach schlafen, und man könnte auf den Dächern schlafen, weil diese flach sind.
Als ich das geschrieben habe, schrieb ich für ein deutsches Publikum, das möglicherweise (!) nicht weiß, dass Menschen im Irak auf dem Dach schlafen und dies auch architektonisch möglich ist. In dem Moment habe ich verraten, für wen ich schreibe, zu wem ich spreche; nämlich zu einem ausschließlich eurozentrischen Publikum, das sich nicht die Mühe macht, herauszufinden, wie die Architektur in Westasien ist.
Ich sehe das bei vielen Kolleg*innen, die etwas erklären, was sie nicht erklären müssten, wenn sie zu mir sprechen würden. Unbewusst schreiben wir also für ein Publikum, das uns nicht verstehen wird. Die Rezeption der Arbeit von migrantischen Schriftsteller*innen entlarvt, wie diese Literatur verstanden wird. (Und auch dieser Essay richtet sich größtenteils an ein ignorantes Publikum.)
Es ist völlig egal, worüber ich schreibe, das deutsche Publikum wird immer darin eine Zerrissenheit zwischen den Kulturen lesen – die Abwesenheit ›deutscher‹ Figuren, der deutschen Geschichte und Diskurse ist eine sehr bewusste Entscheidung von mir als Schriftstellerin, es ist keine politische Entscheidung, sondern eine dramaturgische, für die Themen, die ich behandle (nicht Integration, nicht Rassismus, nicht Ankommen, nicht Fremdgefühle) brauche ich schlicht und ergreifend nichts spezifisch Deutsches außer Deutsch.
Eine Rezensentin schreibt über mein zweites Buch und über mich, ich müsste als Schriftstellerin noch beweisen (sic!), dass ich über andere Figuren und Themen schreiben kann als über junge Migrantinnen, die zwischen den Kulturen und Geschlechterstereotypen ihre Identität suchen.
Das, worüber ich schreibe, wird nicht gesehen, weil migrantische Figuren ohne den Kulturkonflikt nicht existieren können. Die Abwesenheit des ›Deutschen‹ scheint das Publikum derartig zu stören, dass sie diese Abwesenheit als Konflikt lesen, als eine Zerrissenheit zwischen den Kulturen.
Eine Redakteurin verrät mir, ihre Kollegin wollte mein zweites Buch nicht lesen, weil es wieder um ›Kurden‹ geht.
Der Literaturwissenschaftler Albrecht Koschorke schreibt, der Wissenschaftsbetrieb vernichtet die Wissenschaft, ich denke: Auch der Literaturbetrieb vernichtet die Literatur.
Angefangen bei den berühmten Ärztekindern in Schreibschulen (s. Kessler-Debatte) bis hin zu einem sehr primitiven Verständnis von Literatur als Identitätspolitik in der Rezeption.
Ich schicke die Rezension meiner befreundeten Kollegin Rasha, sie antwortet mir lang und ausführlich – erzählt von ihren Erfahrungen und zwischen all ihren Sätzen stechen zwei besonders hervor:
Du schreibst, was du schreiben musst.
Es ist zu viel Arbeit, um Kompromisse einzugehen.
Wenn es einen Grund zum Schreiben gibt, dann um eine neue Sprache, einen neuen Ausdruck für das zu finden, was da ist oder was nicht da ist. Toni Morrison schreibt, Literatur sei eine »alternative language« als die Sprache, die uns tagtäglich umgibt. Wir müssen in die Lage versetzt werden, in einer anderen Sprache zu schreiben, in die Grammatik einzudringen, nicht der Alltagssprache zu verfallen, die Sprache, wie sie gesprochen wird zu brechen, in den Spalt zu schauen und das Gebrochene zu entdecken, gebrochen Deutsch zu schreiben.
Mittlerweile haben auch die Verlage verstanden, dass man nicht Kreatives Schreiben studiert haben muss, um schreiben zu können, aber es hilft für ein zukünftiges Netzwerk, es hilft auch, um diesen Betrieb zu verstehen und dann lese ich einen Tweet von dem Lektor Florian Kessler, der sich als Gatekeeper bezeichnet, weil er einen Debütroman über Obdachlosigkeit als »zu intrinsisch und umfangreich und zu kompliziert« empfand und deswegen ablehnte. Intrinsisch bedeutet hier: Es bedient nicht meine Vorstellung davon, was Obdachlosigkeit ist oder auch meine Vorstellung davon, was die Kaufkräfte sich unter Obdachlosigkeit vorstellen: Es bedient nicht meine Vorurteile.
Wie viele Schriftsteller*innen wurden und werden verhindert, weil ihre Arbeit als ›intrinsisch‹ beurteilt wird? Wahrscheinlich so viele wie es Chirurgensöhne in den Verlagen gibt.
We hunger for a way to articulate who we are and what we mean.
Toni Morrison, wieder.
Ich denke an die kurdische Künstlerin Zehra Doğan, die im türkischen Gefängnis mit allen Mitteln, die ihr zur Verfügung standen, malte. Kunst war für sie kein Luxus, sondern ihre Rettung, vielleicht sogar Rettung davor wahnsinnig zu werden, ganz sicher.
Kunst ist eine Notwendigkeit, für diejenigen, die es erschaffen. Kunst ist Ausdruck, keine Pose. Das Beispiel soll nicht zu dem Vorurteil beitragen, leidende Künstler*innen wären die besseren Künstler*innen. Trotz der widrigsten Umstände entsteht Kunst, aber möchte das »Land der Dichter und Denker« wirklich die widrigsten Umstände als Arbeitsalltag für Künstler*innen akzeptieren?
Ich weiß: Kunst ist kein Luxus, den ich mir erlaube, sondern eine Notwendigkeit; Geld sollte nicht darüber bestimmen, was ich mache und doch entscheidet Geld über alles, und dies zu ignorieren, bedeutet die Realität zu leugnen.
Autorin:


Karosh Taha wurde 1987 in Zaxo geboren. Seit 1997 lebt sie im Ruhrgebiet.
Ihr Debütroman ›Beschreibung einer Krabbenwanderung‹ erschien 2018 bei DuMont. Sie wurde mit zahlreichen Stipendien und Preisen ausgezeichnet, darunter der Förderpreis des Landes NRW, das Stipendium Deutscher Literaturfonds und das Rolf-Dieter-Brinkmann-Stipendium 2019.