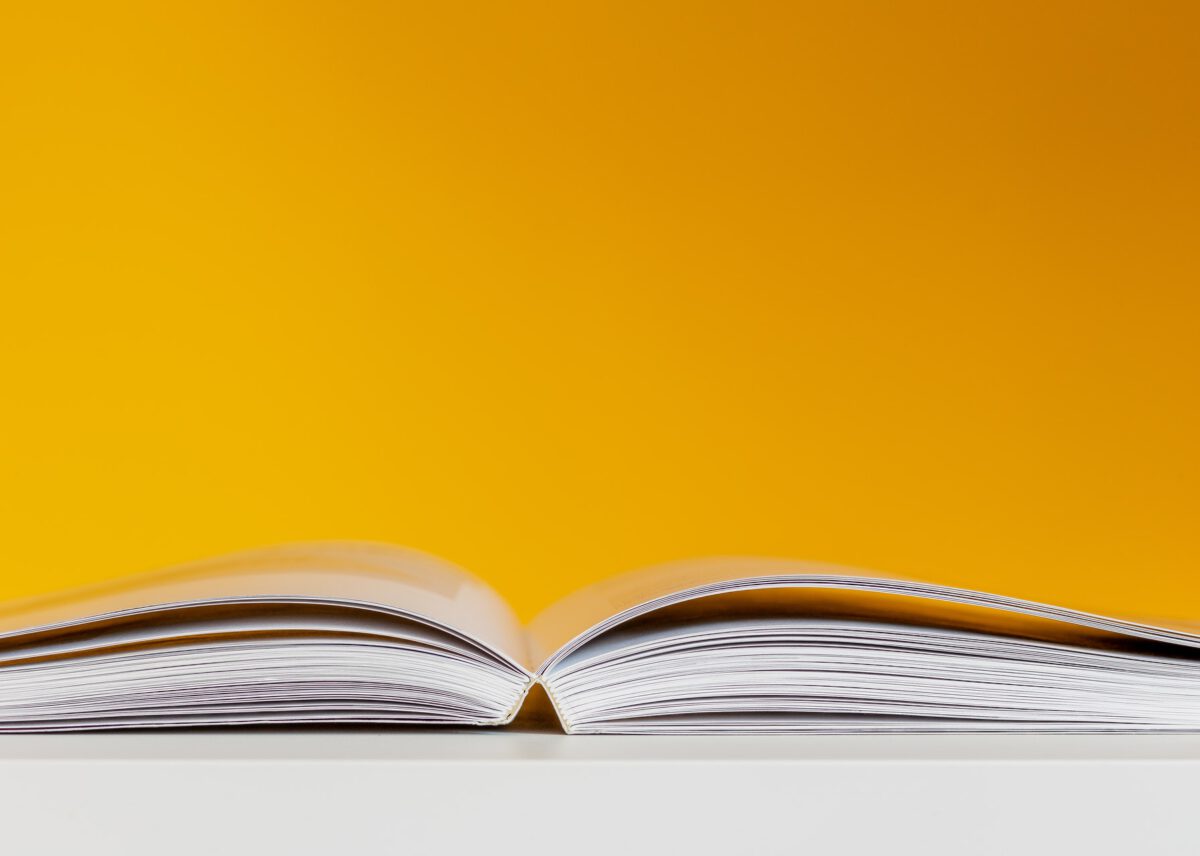Wir erleben einen Epochenwechsel. Das globale Kultursystem ist lahmgelegt und überwintert nach jahrelanger Überhitzung in bedrohlicher Kühle. Seit Monaten leben Tausende von Kulturschaffenden und Kulturinstitutionen mit existenziellen Unsicherheiten. Die Pandemie zeigt die Ungleichheit und die Prekarität des Kultursektors ebenso schmerzhaft wie seinen Nachholbedarf in Sachen Lobbying und Digitalisierung. Und sie beginnt bereits die künftigen Strukturen zu prägen.
Die einzige Möglichkeit, aus dieser belastenden Situation eine Chance zu machen, liegt darin, die Bedingungen für die Zeit nach der Krise mitzugestalten. Wagen wir daher einen Blick in die Zukunft. Lernen wir von den Errungenschaften, die in vielen künstlerischen Aktionen aus Not entstanden sind. Nicht umsonst hat der Bund im Covid19-Gesetz[1] Finanzhilfen für Transformationsprojekte zur Verfügung gestellt, die gemeinsam mit den Kantonen unterstützt werden können. Denn Transformieren oder transformiert werden, das ist die entscheidende Frage für den Kultursektor. Fünf Themen sollten Kulturpolitik, Kulturinstitutionen und Kulturschaffende dabei berücksichtigen.
Bessere soziale Absicherung der kulturellen und kreativen Berufe
Der Kultursektor ist wesentlich geprägt von Freischaffenden[2], die sich in höchster Verwundbarkeit und Abhängigkeit befinden. Etwa 15.000 Kulturschaffende sind in der Schweiz mit hohem Einsatz und wenig Absicherung tätig, ihr Status ist in gängigen Berufskategorien schwer zu erfassen und folglich schlecht geschützt: Musiker*innen und Tontechniker*innen, Tänzer*innen oder Kurator*innen, allesamt Angestellte im Kulturbereich mit befristeten Arbeitsverträgen bei häufig wechselnden Arbeitgeber*innen. Dies ist die Realität einer sehr dynamischen Branche, die kaum Festanstellungen bietet.
Die Freischaffenden tragen in unzähligen Projekten zum Reichtum unseres Kulturlebens bei – leider bleibt auf ihrer Seite wenig davon hängen, selbst wenn sie erfolgreich arbeiten, fallen sie durch die Maschen der Vorsorge-, Hilfs- und Absicherungssysteme und stehen am unteren Ende der Lohnskala. Ihnen verdanken wir einen Großteil der Festivals, Bücher, Tanzprojekte, Ausstellungen und Clubabende.
Abgesehen von angemessenen Honoraren ist es dringlicher denn je, die Besonderheiten dieser Berufsgattungen endlich im Sozialsystem abzubilden und ihnen einen Anspruch auf Arbeitslosenversicherung zu sichern. Die Schweiz hat hier Nachholbedarf, die bisherigen Nothilfemaßnahmen zeigen dies eindrücklich. Mögliche Teilmodelle aus Deutschland oder Frankreich können als Diskussionsgrundlage dienen, Suisseculture und andere Verbände sind ideale Gesprächspartner, um eine tragfähige Lösung zu entwickeln:
Die Pandemie hat die beschriebene Problematik verdeutlicht und für viele Betroffene schmerzhaft gezeigt, wie schwierig es ist, in einem staatlichen Nothilfesystem die zahlreichen freischaffenden Kulturberufe angemessen und fair zu erfassen. Es scheint daher absolut naheliegend und zwingend, die Frage der sozialen Absicherung von freien Kulturschaffenden in einem größeren Kontext anzugehen und auf eine politische Lösung hinzuwirken. Gelingt dies nicht, droht ein Segment an Kreativen wegzubrechen, das in unzähligen zeitgenössischen Formaten das Kulturleben der Zukunft wesentlich mitprägen würde.
Nachhaltige Prozesse statt kurzlebige Produkte fördern
Die gegenwärtige Krise zeigt in zugespitzter Form, in welchem Maße der Kultursektor ein Output-orientiertes System ist, das international eine wachsende Produktionsdichte bei abnehmender Präsentationsdauer fördert: Heute ist ein Werk hier, morgen dort und übermorgen wird es durch ein neues ersetzt. Dies ist ökonomisch und ökologisch wenig nachhaltig und führt zu großem Verschleiß. Unter der Hektik leiden auch die kreativen Prozesse. Wer je einem Orchester beim Proben zugehört hat, weiß, wie wichtig die Momente des Suchens sind, denn Klang ist nicht gleich Klang, er muss gefunden werden.
Kulturmarkt und Subventionspolitik haben Institutionen und Kunstschaffende über Jahre auf Outputsteigerung, Hypermobilität und Kurzlebigkeit gepolt. Der Kultursektor braucht aber mehr Nachhaltigkeit, bessere Verwertungs- und Wirkungsketten. Dafür muss er auf die Langfristigkeit von Prozessen setzen, zum Schutz der Ressourcen, Kreativität und Natur. Die Pandemie hat dafür eine Art »in vivo«-Experimentierlabor geschaffen: Im Zentrum der kulturellen Arbeit steht momentan zwangsläufig der künstlerische Prozess, die Recherche, und weniger das fertige Produkt und dessen Präsentation.
Dadurch hat auch das Lokale und der direkte Einbezug der Menschen vor Ort an Bedeutung gewonnen. Kurze Wege sollen aber nicht Provinzialisierung bedeuten, denn gerade mit bewusster lokaler Verankerung muss es weiterhin darum gehen, einen internationalen Austausch zu pflegen: Kunst und Kultur entstehen aus dem Dialog mit anderen Realitäten. Für die Kulturförderung wird es künftig darum gehen, die Förderempfänger*innen nicht nur an Produktions-Ergebnissen, sondern auch an Prozessen zu messen. Recherchen, technologische Experimente oder offene Austauschprozesse sollten dezidiert Teil des Auftrags sein. Der Kulturbereich wird dadurch wesentlich an Qualität und Nachhaltigkeit gewinnen.
Raum schaffen für Transdisziplinarität und neue Sprachen
Lange Zeit wurde der Begriff der künstlerischen Qualität von Institutionen nach bestimmten ästhetischen Filtern diktiert, die einer disziplinären Logik folgen und bis heute die Kulturförderung bestimmen. Mit zunehmender Popularität digitaler Praktiken entstehen neue soziale Konstruktionen von Qualität, die mit jenen der Institutionen konkurrieren. Im Reich von TikTok & Co. findet sich hierzu endloses Anschauungsmaterial.
Theaterregisseur Arne Vogelgesang experimentiert schon lange mit Netz-Formaten: »Man traut sich Live-Streams von den Proben oder Opern-Kommentare auf Twitch – wo beide Seiten erstmal verwirrt sind, sowohl das Internet-Laufpublikum als auch die Opern-Besucher. Diese Überkreuzung von Welten finde ich das Spannendste im Moment: mit dem zu experimentieren, was Publikum und Publikumsbeziehung bedeutet.«
Für die institutionelle Kultur und ihre Förderung stellt sich die Frage, wie und von wem das künftige Verständnis von Qualität erarbeitet wird. Das Verhältnis zum Publikum, auch der Einbezug von und die Interaktivität mit neuen Publika sind hier wichtige Herausforderungen. Transdisziplinäre Formate bereichern darüber hinaus den künstlerischen und außerkünstlerischen Dialog indem sie Kompetenzen aus verschiedenen gesellschaftlichen Kontexten einbeziehen. Dies kann zu hybriden Produktionsformen und Prozessen führen. Der Tänzer, die VR-Spezialistin und der Modedesigner für eine Modeschau, der Klangforscher und die Geologin für ein Landschaftsprojekt interagieren und suchen eine gemeinsame, vielleicht neue Sprache. Transdisziplinarität fordert dazu heraus, die eigenen Verständnisräume und Denkkategorien zu verlassen und sich auf unvertraute Zusammenhänge einzulassen. Für Kulturinstitutionen liegt die Herausforderung darin, nicht in beliebige Aktivismen zu verfallen, sondern gezielt neue Sprachen zu lernen und die relevanten Akteure außerhalb ihrer ursprünglichen Bestimmung einzubinden.
Das Publikum findet seine Kultur nicht nur dort, wo die Kultur ihr Publikum sucht
Untersuchungen aus der Zeit der Pandemie belegen, dass die Menschen nicht weniger Kultur konsumiert haben, sie haben sie bloß anderswo gesucht und gefunden als bisher. Eine Studie des Unternehmensberaters Deloitte weist für Deutschland eine erhöhte Mediennutzung zwischen 38 % (Konsolen) und 55% (Mediatheken) aus. Dabei wirkt die Pandemie wie ein Katalysator: Digitale, qualitativ hochwertige Inhalte wurden stärker genutzt, zugleich beschleunigte sich der Rückgang bei traditionellen Medienangeboten.
Es gibt also entgegen unbelegten Gerüchten einen großen Appetit nach Kultur. Nur wird dieser Appetit nicht unbedingt dort gestillt, wo traditionellerweise die kulturellen Speisen offeriert werden. So stellt sich die entscheidende Frage, von wem und für wen künftig was angeboten und verbreitet wird. Das Geschäft mit der Veränderung des Publikumsverhaltens wird meist von Instanzen betrieben, die nicht zum herkömmlichen Kulturbetrieb gehören und sehr viel Einfluss auf das Kulturleben der Zukunft haben.
Amazon verdreifachte im 3. Quartal 2020 seinen Gewinn auf den bisherigen Rekordwert von 6,3 Mrd. Dollar. Aber was kann der Kultursektor tun, statt den Plattformkapitalismus zu beklagen und zugleich mangels Alternativen Youtube, Twitch und Spotify zu nutzen? Die Antwort ist etwas unbequem und lautet: Akzeptieren, dass das Netz für den herkömmlichen Kulturbetrieb kein feindlicher Raum ist und daran arbeiten, die Verteilverhältnisse zu verändern. Eine zentrale Aufgabe künftiger Kultur- und Institutionenpolitik könnte es sein, alternative, selbstorganisierte Plattformen zu ermöglichen, auf denen die Mittel- und Informationsverteilung, die Produktion und Distribution eigenständig und produzentenfreundlich organisiert wird. Das ist machbar und reizvoll, auch in der Schweiz. Die Erfahrungen während der Pandemie haben gezeigt, dass dies keine Utopie sein muss, es gibt Menschen in den Startblöcken.
Die Grenze des Digitalen beginnt bei der Realität des Körpers
Mit dem Zuwachs an digitalen Angeboten im Web kann das Bedürfnis nach Inhalten zeitgleich lokal und international sehr viel breiter bedient werden, auch partizipatorischer, als dies Kulturinstitutionen auf analoge Art schaffen. Die digitale Kulturwelt ist populär, divers und zugänglich, jederzeit und überall verfügbar. Diese Potentiale sind es, die sich die analoge Kultur vermehrt aneignen muss, um ihre inhaltlichen Stärken beim Publikum auszuspielen. Das Bedürfnis nach physischem Zusammenkommen, das Verlangen nach körperlicher Begegnung wird die zentrale Realität des Kultursektors bleiben, denn der Sinn von gelebter Kultur ist direkte Interaktion.
Alles zu Digitalisieren oder in virtuelle Formate zu bringen, wünschen wir uns nicht, es geht um ergänzende oder hybride Formate. Die Möglichkeiten der Interaktion zwischen analog und digital sollten deshalb vorurteilsfrei ausgebaut werden, so dass aus der noch platten Idee des Streamings mehr wird als eine Notlösung für die nächste Pandemie. Nur der direkte, gleichberechtigte Kontakt zwischen Menschen an einem gemeinsamen Ort – ob analog oder digital – ermöglicht offenen Dialog oder Widerspruch, die beide für unsere Gesellschaft existenziell wichtig sind. Kultur ist immer auch ein Angebot für Demokratiebildung. Kann man sich dabei nicht in die Augen schauen, fehlt etwas Entscheidendes zum Mitdenken, Mitfühlen und Mitstreiten.
Die bereits begonnene Transformationsphase wird eine Gelegenheit sein, uns darauf zu verständigen, welche kulturellen Werte wir als Gesellschaft fördern wollen. Für uns alle, hoffe ich, ob als Publikum, Kulturschaffende, Veranstalterinnen oder Kulturförderer, wird es darum gehen, den Weg zu öffnen zu einem Kulturbetrieb, der nachhaltiger, prozesshafter und verteilgerechter wird.
Autor:

Philippe Bischof (1967) ist seit dem 1. November 2017 Direktor der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia. Nach Studien in Basel begann er seine Laufbahn als Regieassistent am Theater Basel. Anschließend arbeitete er als Regisseur und Dramaturg im In- und Ausland sowohl an Stadttheatern wie auch in der freien Szene.
Hinweis: Die Zeitung »Schweiz am Wochenende« hat den Direktor der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia eingeladen, in einer Carte Blanche seine Gedanken zur Zukunft des Kultursektors und der Kulturpolitik zu formulieren. Der dabei entstandene Text konzentriert sich bewusst auf einige Zukunftsthemen, die struktureller Art und eng miteinander verbunden sind, wohl wissend, dass es auch andere Dringlichkeiten gibt: Etwa Fragen der Diversität und Chancengleichheit, die ebenfalls in einer künftigen Kulturpolitik prioritär zu behandeln sind.
[1] Mit diesem Gesetz hat der Schweizer Bundesrat finanziellen Maßnahmen zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie beschlossen (vgl. https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/711/de, letzter Zugriff 26.01.2021). Art. 11 regelt die Maßnahmen im Kulturbereich, u.a. auch die sog. Transformationsprojekte: »Kulturunternehmen mit Sitz in der Schweiz können für Projekte, welche die strukturelle Neuausrichtung oder die Publikumsgewinnung zum Gegenstand haben, bei den Kantonen dafür Finanzhilfen beantragen. Bitte beachten Sie: Die Finanzhilfen decken höchstens 80 Prozent der Kosten eines Projekts. Sie betragen maximal 300 000 Franken pro Kulturunternehmen.« (vgl. https://www.bak.admin.ch/bak/de/home/themen/covid19/massnahmen-covid19/kulturelle-unternehmen.html, letzter Zugriff 26.01.2021) Transformationsprojekte umfassen zwei Kategorien von Vorhaben: Zum einen sind Vorhaben förderfähig, die eine strukturelle Neuausrichtung des Kulturunternehmens zum Gegenstand haben. Damit sind Vorhaben wie organisatorische Verschlankungen, Kooperationen verschiedener Kulturunternehmen oder Zusammenschlüsse (Fusionen) gemeint. Zum anderen können Projekte unterstützt werden, welche die Wiedergewinnung von Publika oder die Erschließung neuer Publikumssegmente bezwecken. Die Kantone haben bei der Auswahl der Projekte respektive der Beurteilung der Kriterien nach Artikel 8 einen großen Ermessensspielraum.
[2] Der Begriff »Freischaffende*r« ist in der Schweiz seit langem Gegenstand politischer Diskussionen rund um die Frage der sozialen Absicherung von Kunstschaffenden. Dies hat damit zu tun, dass die freischaffenden Berufsbilder jenseits des eindeutigen, offiziell anerkannten Selbständigen-Status oft nicht klar definiert bzw. erfasst sind und dementsprechend auch nicht anspruchsberechtigt im Zusammenhang mit sozialen Leistungen, Arbeitslosenversicherung. In Diskussionen wird oft auf den Status der Intermittence in Frankreich oder auf die Künstlersozialkasse Bezug genommen. Im Covid-19-Gesetz gilt folgendes: Unter den Begriff der Kulturschaffenden fallen alle Personen, die hauptberuflich im Kulturbereich tätig sind. Dazu zählt insbesondere auch technisches Personal (Ton, Beleuchtung usw.). Nicht erforderlich ist eine ausschließlich selbständige Tätigkeit. Erfasst sind auch Kulturschaffende, die eine Kombination aus selbständiger und angestellter Tätigkeit ausüben. Um den zahlreichen atypischen Arbeitsverhältnissen im Kulturbereich Rechnung zu tragen, können auch Kulturschaffende mit befristeten Anstellungen eine Nothilfe erhalten. Die Definition der hauptberuflichen Tätigkeit stützt sich auf Artikel 6 Absatz 2 Satz 1 der Kulturförderverordnung (KFV; SR 442.11) ab. Hauptberuflich im Kulturbereich tätig sind damit Kulturschaffende, die mit ihrer künstlerischen Tätigkeit mindestens die Hälfte ihres Lebensunterhaltes finanzieren oder mindestens die Hälfte der Normalarbeitszeit für die künstlerische Tätigkeit einsetzen. Maßgebend sind dabei auch künstlerische Tätigkeiten (selbständig erwerbend oder angestellt) außerhalb des Kunstsektors gemäß vorliegender Definition (z.B. Tanzlehrerin an einer Tanzschule). Das Vorliegen einer hauptberuflichen Tätigkeit ist im Einzelfall gestützt auf die durch die Kulturschaffenden beizubringenden Unterlagen zu beurteilen (z.B. Steuerabrechnungen, Liste von Engagements, Ausstellungen usw.).