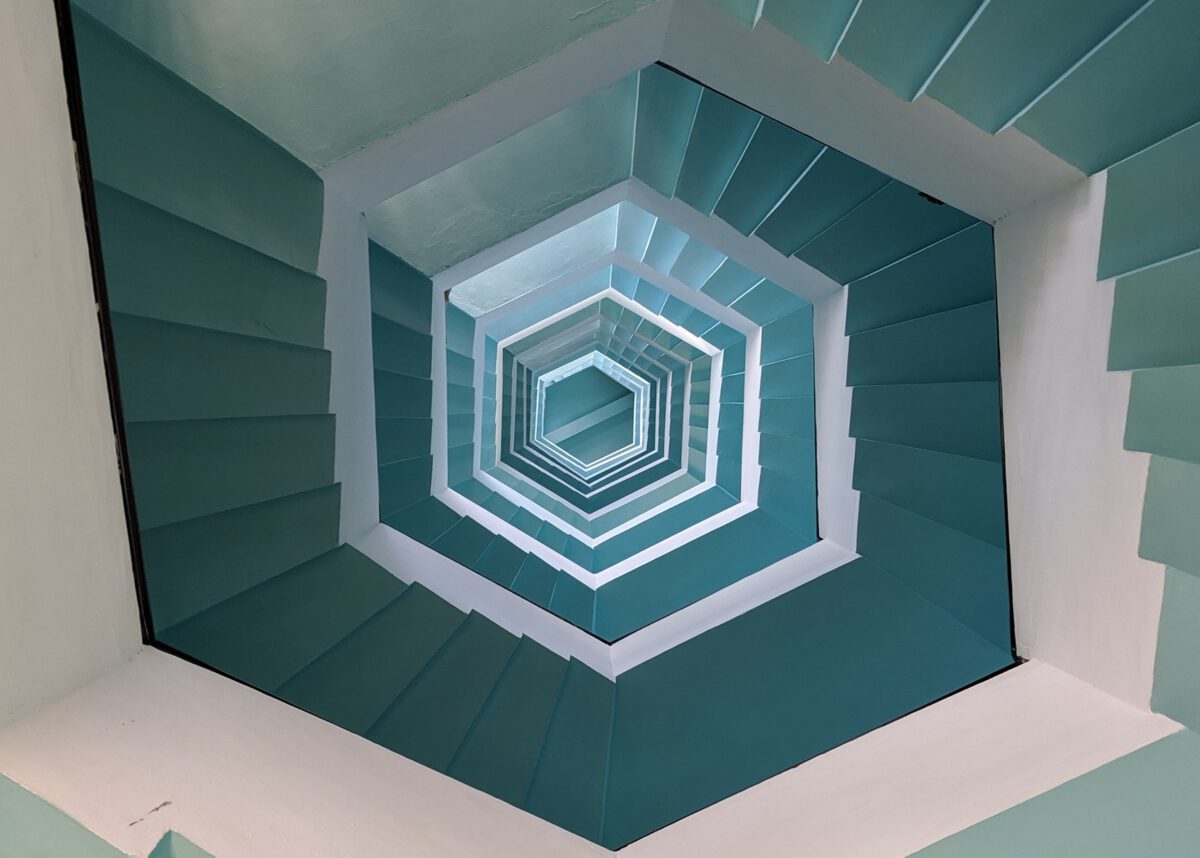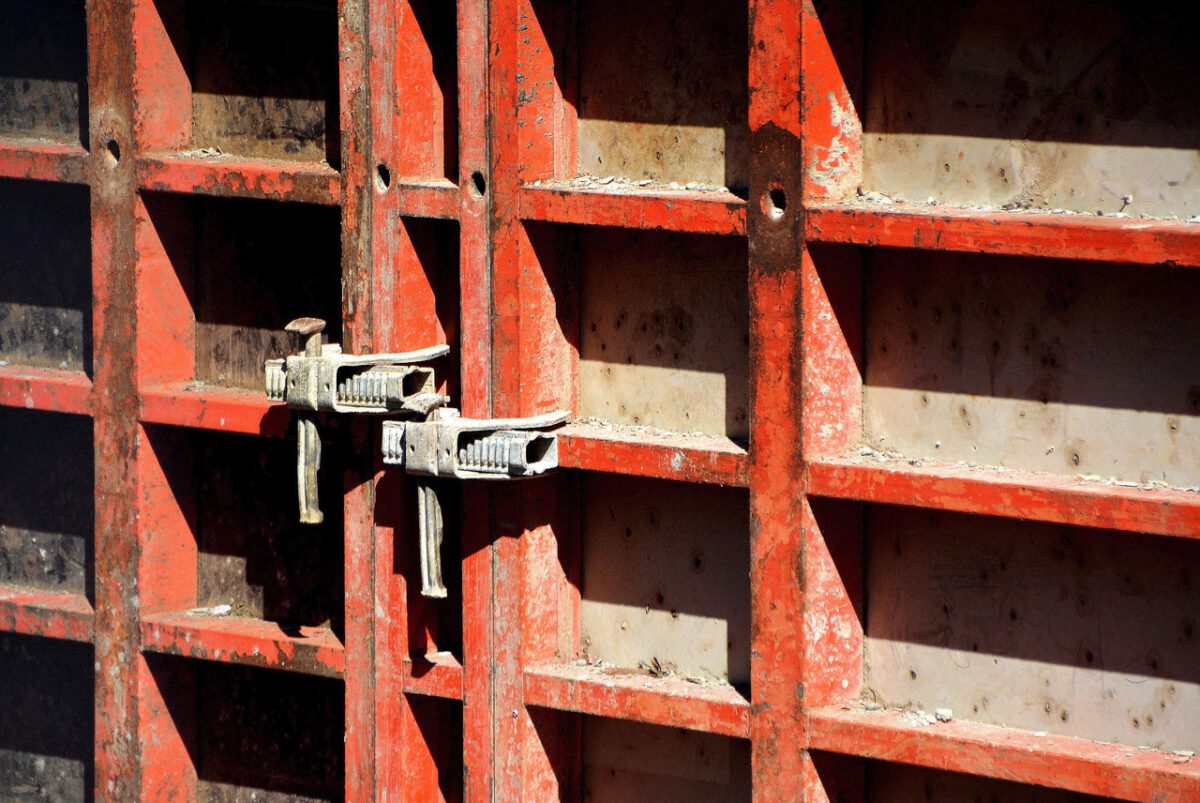Wenn von den Lehren aus der Pandemie die Rede ist, dann fällt fast immer der Begriff der Resilienz, die die Kultur entwickeln muss. Darunter wird gemeinhin die Widerstandfähigkeit verstanden, Krisen durch den Rückgriff auf gesammelte Erfahrungen und Ressourcen für Weiterentwicklungen zu nutzen, eben Krise als Chance. In der Medizin und der Physik hat Resilienz eine etwas andere Bedeutung, nämlich die Wiederherstellung einer früheren Situation: Druck aufnehmen zu können, ohne zu zerbrechen, und in den Ursprungszustand zurückkehren – so wie ein Ball oder ein Stoßdämpfer. Bei den Szenarien, die der Kulturbereich derzeit für die Post- Corona- Ära entwirft, dominiert eher diese zweite Interpretation von Resilienz. Das ist nicht abwegig: Kunst- und Kulturschaffende und die Institutionen wollen – wie auch andere gesellschaftliche Sektoren – in den gewohnten Arbeitsmodus zurückkehren. Vermutlich entspricht das auch der Erwartungshaltung ihres Publikums. Aber war dieser ursprüngliche Zustand so erstrebenswert?
Kultureinrichtungen in kommunaler und Landesträgerschaft und -finanzierung werden dies überwiegend bejahen: Ihr Status sichert ihnen Resilienz, und auch während der Pandemie waren sie nie wirklich existenziell gefährdet. Bei aller Kritik an den Corona-bedingten Restriktionen im Kulturbereich ist zu konstatieren, dass nie so viel Empathie und staatliches Geld vorhanden war – sogar für die freie, zivilgesellschaftlich getragene Kultur. Das tat gut. Aber wie ist die Perspektive? Wie beurteilen die Künstler*innen und andere Betroffene sowie die freien, zivilgesellschaftlich getragenen Kultureinrichtungen ihre Existenzbedingungen vor der Pandemie? Und was erwartet sie für die Zeit danach?
Ungelöste Förderarithmetik
Corona hat das Brennglas auf die Lage dieses Kultursegments gelenkt, das neben den öffentlichen Institutionen als eine zweite Säule des kulturellen Lebens in Deutschland durchaus geschätzt wird. Für ihre künstlerischen Innovationen und Qualitäten wird sie gelobt. Auch die Publikumszahlen der Freien Szene sind im Vergleich mit etablierten Kulturbetrieben beachtlich: Beispielsweise verzeichneten 2017 die soziokulturelle Zentren 12,6 Mio. Besuche, öffentliche Theater 20,5 Mio. Ihre materiellen Rahmenbedingungen halten jedoch mit ihrer Wirksamkeit nicht Schritt.
Bis Anfang der 1970er Jahre konzentrierte sich die öffentlichen Kulturpflege in der alten Bundesrepublik auf die Finanzierung der eigenen Theater, Museen, Bibliotheken, Musikschulen und andere, überwiegend kommunale Institute. Daneben gab es ein bisschen Hilfen für Künstler*innen und die Unterstützung kultureller Gemeinschaften. Ganz wenige Einrichtungen wurden kontinuierlich gefördert wie etwa die Kunstvereine. Mit der Entstehung einer freien und sozio- kulturellen Szene und ihrer Forderung nach einer Beteiligung am Kulturkuchen öffnete sich das System. Zunächst waren es vor allem Projektzuschüsse, später auch dauerhafter angelegte Förderprogramme insbesondere für Einrichtungen wie soziokulturelle Zentren, Jugendkunstschulen oder freie Theaterspielstätten.
Stets fielen diese Förderungen im Vergleich mit dem etablierten Kulturbetrieb geringer aus, und es wurden im Laufe der Zeit auch immer mehr, die sich in diesem neuen und differenzierten, Möglichkeiten und Distinktion versprechenden Kulturfeld zuwandten. Die Kulturpolitik selbst formierte sich alternativ: Sie war den neuen Entwicklungen, die einen Modernisierungsschub für den traditionellen Kulturkanon versprachen, gegenüber aufgeschlossen, und tat das in ihrem Rahmen Mögliche zur Unterstützung. Neue Themen wie Zielgruppen, Interkultur, Partizipation, Dezentralisierung und Alltagskultur(orte) fanden Eingang in die kulturpolitische Agenda. Diese Neue Kulturpolitik half der Bewegung auf die Beine, indem sie einen ideologischen Überbau und zusätzliche Finanzmittel für das Feld organisierte. Kritik hielt sie sich vom Leibe, indem sie den Besitzstand der alten Kulturkohorten nicht angriff. Diese Strategie hatte den Nebeneffekt, dass die Kulturetats seit fast 50 Jahren beständig anwachsen und mit dem Aufwuchs der öffentlichen Haushalte durchaus Schritt gehalten haben.
Allerdings kam und kommt der Großteil der Steigerungsraten den Konten der öffentlich getragenen, personal- und damit kostenintensiven Kultureinrichtungen zugute. Trotz vieler guter und durchdachter Förderansätze und -konzepte in den vergangenen Dekaden ist das Gefälle zwischen etabliertem Kulturbetrieb und freiem Kulturbereich immer noch eklatant, obgleich seine gesellschaftliche Wirksamkeit, sein künstlerisches Potential und seine Teilhabezugänge unstrittig sind. Prekäre und unzureichende Arbeitsbedingungen, fehlende finanzielle Planungssicherheit, Raumprobleme, Kampf um Sichtbarkeit und Anerkennung und letztlich um Mitgestaltung der öffentlich verantworteten Kulturentwicklung, und zwar auf Augenhöhe und nicht als Bittsteller: Das sind nach wie vor zentrale Herausforderungen für diese zweite Kultursäule.
Normallfall Projektförderung
Wer die Forderung nach Resilienz für die freie und soziokulturelle Szene nach Corona ernst nimmt, muss die Frage nach der Angemessenheit und Zukunftsfähigkeit des Kulturfördermodells in Deutschland beantworten. Das betrifft die kulturpolitische Relevanz der großen gesellschaftlichen Themen wie Klimawandel und nachhaltige Ökonomie, Globalisierung, Armut und Teilhabe, Diversität oder die Digitalität, aber eben auch ganz banal die Finanzierungsungleichheiten im Kultursektor. Wenn durch die Pandemie die Verletzlichkeit der nicht-staatlich oder kommunal verfassten Kultur überdeutlich hervorgetreten ist, wäre jetzt der Zeitpunkt eines grundlegenden Systemwechsels, der sich primär an die Sachwalter der Kulturfinanzierung auf Bundes-, Länder- und kommunaler Ebene richtet.
Es gilt Abschied zu nehmen von einem Förderverständnis, das die freie Szene vor allem auf Maßnahmen reduziert, die zeitlich befristet und jederzeit rückholbar sind. Auf den Prüfstand müssen u.a. die Praxis der Ketten-Projekte für die Finanzierung von Einrichtungen, institutionelle Förderungen, die aber auf dem Regelwerk für die Projektförderung basieren, Optionsförderungen, die besonders qualifizierten Trägern für einige Jahre ein Auskommen ermöglichen, danach aber keine weitere Perspektive eröffnen, das Primat von Produktions- gegenüber Prozessergebnissen sowie Anteilfinanzierungen, bei denen erfolgreiche Eigenerwirtschaftung und Drittmittel die Förderung reduzieren und unflexibel und bürokratisch zu handhaben sind.
Selbst die großzügigen Corona-Hilfen staatlicher und kommunaler Herkunft spiegeln die Asymmetrie zwischen einer zeitlich eingegrenzten und einer nachhaltigen Förderung wider, denn die allermeisten Zuwendungen werden projektbezogen vergeben. Das bedeutet für die Projektverantwortlichen, dass sie antragsbasiert und (innovations)orientiert an definierten Kriterien für ein erwartetes Ergebnis arbeiten, verwendungsnachweispflichtig entsprechend der geltenden Allgemeinen Nebenbestimmungen sind, sowie der Notwendigkeit unterliegen, nach einem erfolgreich durchgeführten Projekt sogleich das nächste zu platzieren, um durch die anhaltende Krise zu kommen. Auch wenn viele Akteur*innen diesen Modus als Normalzustand kennen, hätte man sich doch wenigstens während des pandemischen Ausnahmezustands eine beständigere Unterstützung gewünscht.
Die Frage der qualitativen Bewertung – wer sie nach den Regeln von Zugänglichkeit, Transparenz, Nachvollziehbarkeit sowie eigener Fachkompetenz vornimmt und letztlich die Förderentscheidungen trifft – ist konstitutiv für die Akzeptanz jeder Kulturförderung. Doch gerade die Qualitätsfrage wird in Deutschland ungern offen diskutiert und kommuniziert; teilweise wird sie sogar als zu subjektivistisch bei Förderprozessen ausgeklammert. Dabei mag ein starkes Ausstattungs- und Finanzierungsgefälle zwischen öffentlichen und freien Trägern auch zukünftig durch qualitative Unterschiede durchaus begründbar sein, vielfach aber auch nicht.
Wenn beide Welten einmal aufeinanderstoßen wie beim Berliner Theatertreffen, bei dem seit einigen Jahren auch freie Produktionen zugelassen werden, sind die vielfach bemühten Qualitätsunterschiede nicht auszumachen. Im Jahr 2021 kamen schon drei von zehn eingeladenen Inszenierungen aus dem frei-produzierenden Bereich. In der kulturellen Bildung räumen besonders viele zivilgesellschaftliche Institutionen wie etwa Jugendkunstschulen oder Medienwerkstätten renommierte Preise ab. Was die freie Szene an neuen Methoden und Formaten erprobt und entwickelt hat, wird oft vom öffentlichen Kulturbetrieb adaptiert – allerdings unter deutlich besseren Rahmenbedingungen.
Dynamische Fördersysteme
Manchmal lohnt der Blick nach außen, z.B. in die Niederlande. Mit der Aktion Tomate (Aktie Tomaaat) protestierten 1969 (!) junge Theaterleute gegen eine verkrustete Theaterstruktur, was in der Folge die niederländische Kulturlandschaft insgesamt dauerhaft verändert hat. Für die vierjährigen Legislaturperioden legt ein Kunstplan die staatlichen Förderungen für die öffentlichen und zivilgesellschaftlichen Kulturinstitutionen und -organisationen fest. Nicht das für Kultur zuständige Ministerium oder eine staatliche Behörde bewerten die Förderanträge und treffen die Förderentscheidungen, sondern ein Rat für die Kultur aus Fachleuten.
Ebenfalls alle vier Jahre wird die Förderperiode evaluiert und unter Berücksichtigung der Ergebnisse ein neuer Kunstplan aufgelegt. Mit seiner Umsetzung sind häufig Stiftungen und Fonds betraut (»Förderung auf Armlänge«). Gesetzlich ist das Verfahren, das vergleichbar auch in den Provinzen und Kommunen praktiziert wird, im Cultural Policy Act (1993) geregelt. Dieses System hat zu einer Flexibilisierung, Diversifizierung, Transparenz und Öffnung der Förderstrukturen geführt, die Förderzugänge der unterschiedlichen Kulturträger weitgehend gleich- und Erbhöfe infrage gestellt. Obwohl bis zu 30 % der staatlichen Kulturmittel in den vergangenen Förderperioden umgeschichtet worden sind, geht es nicht um maximale Flexibilität oder eine neoliberale Marktidee. Die Erfahrungen zeigen, dass auch die kulturelle Substanz des Landes nicht verloren hat; ganz im Gegenteil wird sie durch die permanente Anpassungsdynamik gestärkt.
Die skizzierte Konzeption folgt keinem additiven Kulturpolitikmodell, das an seine finanziellen und infrastrukturellen Grenzen kommt, auch nicht einem reduktiven Ansatz, der aufgrund begrenzter Mittel oder Einsparszenarien neuen Entwicklungen restriktiv begegnet oder sie ausschließt. Vielmehr geht es um einen regelmäßig geführten Diskurs über künstlerische und kulturelle Herausforderungen im Kontext gesellschaftlicher Prozesse, bei denen auch die Nachfrageseite und veränderte Kulturinteressen einbezogen sind.
Das Modell privilegiert weder die öffentlichen noch die freien Kulturträger, die den gleichen Maßstäben von Qualität, Wirksamkeit und Effizienz unterliegen. Risiken und Verluste werden bewusst in Kauf genommen, müssen aber fachlich begründet sein. Auf der anderen Seite werden mit einer transformierten Förderkonzeption nachvollziehbare Verfahren und mehr Verteilungsgerechtigkeit erreicht. Die ihr innewohnende Dynamik befördert zudem Veränderungsprozesse bei den Kulturangeboten und ihren Trägern. Denn: Wer Transformation ernst meint, muss auch die materiellen Grundlagen in den Blick nehmen.
Elemente einer verteilungsgerechteren Kulturförderung
Die Forderung nach Resilienz richtet sich vor allem an die Förderinstitutionen und ihre Förderarchitektur. Auch wenn das niederländische System der Kulturfinanzierung in seiner Gänze nicht auf Deutschland übertragen werden kann, so lassen sich doch zentrale Elemente im Förderbereich umsetzen und finden sich in einigen Kommunen und Ländern, bei öffentlichen und privaten Stiftungen sowie den selbstverwalteten Kulturfonds auf Bundesebene, wenn auch bisher überwiegend im Rahmen einer Projektförderung. Eine Neujustierung der Kulturförderung durch deutsche Kulturadministrationen erscheint also durchaus möglich.
Dazu gehören für Einrichtungen und künstlerische Kollektive vor allem eine verlässliche mehrjährige Förderung, Festbetragsfinanzierungen, unabhängige fachliche Expertisen bei Förderentscheidungen, mediatorische Förderfonds, Kombiförderungen durch Land und Kommune, vereinfachte Regeln für Anträge und Mittelverwendungen sowie – ganz wichtig – ein Vertrauensvorschuss (in den Niederlanden sind bis zu Förderbeträgen von 25.000 € keine Verwendungsnachweise erforderlich).
Auf der Seite der Betroffenen bedeutet Resilienz: Diversifizierung der Angebotspaletten, unaufwändige und flexibel einsetzbare Veranstaltungsformate, kleinere und dezentrale Kulturorte, neue Vertriebswege und Vermarktung, Fortsetzung der Digitalstrategien, Diversitäts- und Vermittlungsprogramme, gesellschaftsbezogene Kollaborationen und Vernetzungen, Koproduzieren mit anderen Ensembles und Einrichtungen, subsidiäre Dienstleistungen für Kulturverwaltungen, vor allem aber auch die Stärkung der spartenbezogenen und übergreifenden Interessenvertretungen – denn ohne diese werden Veränderungen der Fördersysteme nicht durchsetzbar sein.
50 Jahre nach der Gründung der ersten freien und soziokulturellen Initiativen dürfte es an der Zeit sein, diesem Bereich mittelfristige Finanzierungsperspektiven zu eröffnen. Das erfordern die erreichte Professionalität sowie der Generationenwechsel in den Einrichtungen, der nur gelingen wird, wenn verlässliche Förderstrukturen die sozialen Standards und Gestaltungsmöglichkeiten sichern. Die Orientierung am gesetzlichen Mindestlohn wie jetzt im Entwurf des NRW- Kulturgesetzbuches führt in die falsche Richtung. Weiterhin auf die intrinsische Motivation der Kunst- und Kulturschaffenden zu setzen, wird nach den negativen und positiven Erfahrungen mit der Pandemie, den existenzgefährdenden Schließungen und den existenzsichernden Hilfspaketen, nicht ausreichen. Die zahlreichen privaten Theater- und Museumsgründungen im vorvergangenen Jahrhundert haben weniger Zeit gebraucht, um sogar den Ewigkeitsstatus öffentlicher Einrichtungen zu erlangen. Wenn in Deutschland schon die Klimaschutzziele bis zum Jahr 2030 nicht erreicht werden: Könnte nicht bis zu diesem Zeitpunkt zumindest eine nachhaltige Kulturförderung verwirklicht sein?
Autoren
Kurt Eichler ist Berater für Kulturpolitik und Kulturplanung und war bis Ende 2017 Geschäftsführender Direktor des Kulturbetriebe Dortmund.